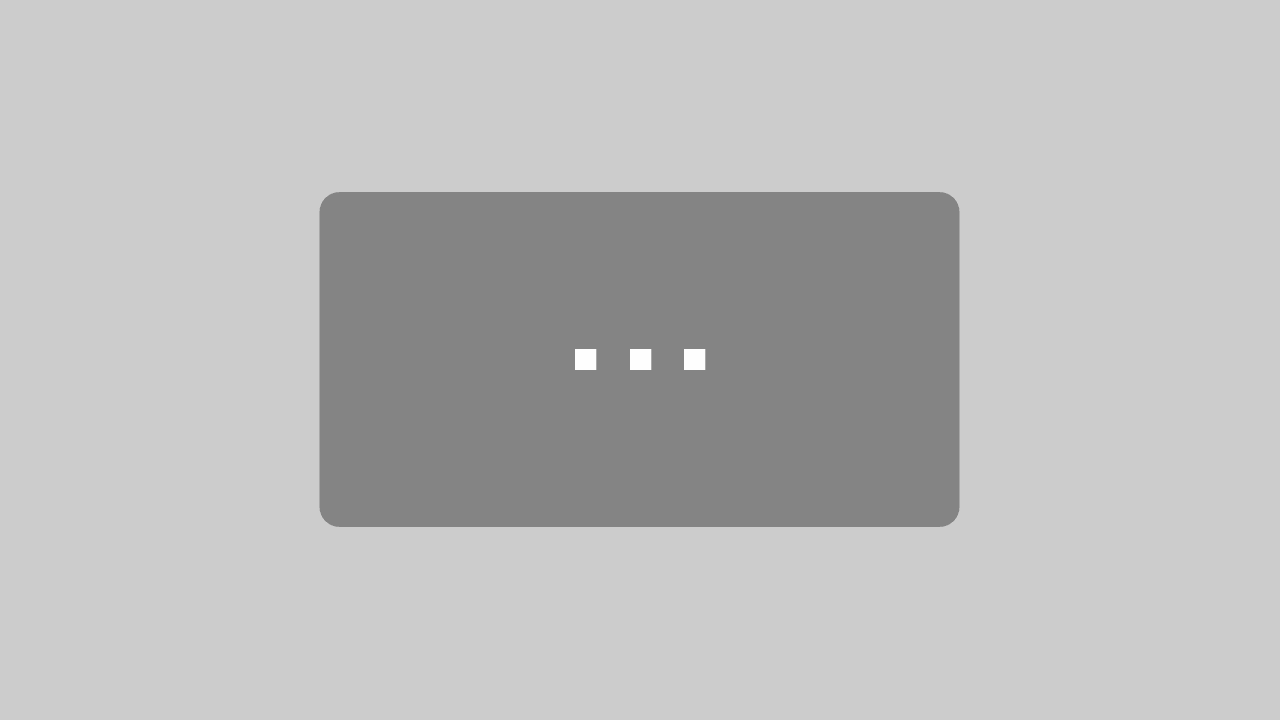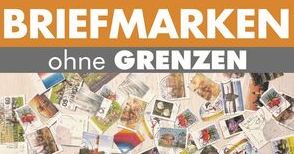Die Stahlindustrie gilt als Rückgrat der saarländischen Industrie – und als Prüfstein für die Energiewende. Im Saarland sollen die Werke in Dillingen und Völklingen auf „grünen Stahl“ umgestellt werden, produziert mit Wasserstoff statt Kokskohle. Die Politik feiert das als Fortschritt, die Industrie fordert Milliardenhilfen. Doch hinter den Schlagzeilen offenbart sich ein ernüchterndes Bild: Die Produktion von grünem Wasserstoff in Deutschland ist strukturell unwirtschaftlich – und selbst Vorzeigeprojekte wie der Bau eines Elektrolyseurs im saarländischen Fenne scheitern an den ökonomischen und regulatorischen Realitäten. Deutschland droht so den Anschluss zu verlieren. Eine nüchterne Bestandsaufnahme.
1. Grünstahl im Saarland – Hoffnungsträger mit schwerem Gepäck
Die Stahlstandorte Dillingen und Völklingen stehen vor einem historischen Umbruch: Die klassische Hochofenroute mit Kokskohle soll durch wasserstoffbasierte Direktreduktion ersetzt werden – ein Schritt in Richtung „grüner Stahl“. Doch die Vision hat einen hohen Preis.
Die Umstellung erfordert Milliardensubventionen, einen massiven Strombedarf und die kontinuierliche Versorgung mit grünem Wasserstoff, der in Deutschland bislang kaum wettbewerbsfähig produziert werden kann. Die Industrie fordert deshalb nicht nur einen dauerhaft subventionierten Industriestrompreis, sondern auch sogenannte „grüne Leitmärkte“, durch die Abnehmer gezwungen werden sollen, den teuren Stahl politisch bevorzugt abzunehmen.
Doch die Zweifel wachsen: Kann dieser Stahl jemals ohne staatliche Bezuschussung bestehen? Der spektakuläre Rückzug von ArcelorMittal aus entsprechenden Projekten in Deutschland spricht Bände[1]. Die Sorge ist greifbar, dass hier ein industriepolitisches Prestigeprojekt entsteht – mit fraglicher Marktlogik und hohem Subventionsbedarf auf Dauer.
2. Verso-Vertrag: Ein Meilenstein – oder nur ein Tropfen?
Anfang September 2025 wurde ein Abkommen zwischen der SHS-Gruppe und dem französischen Energieunternehmen Verso Energy zur Versorgung der Stahlindustrie mit grünem Wasserstoff aus dem französischen Carling als Durchbruch gefeiert[2]. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sprach von einem „Meilenstein für die Zukunft der saarländischen Stahlindustrie“. Doch bei genauerem Hinsehen relativiert sich der Jubel: Der Vertrag sichert lediglich 6.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr – das entspricht nur etwa 1/20 der Menge, die die SHS-Gruppe langfristig für ihre Dekarbonisierungsstrategie benötigt. Die Zielmarke liegt bei 120.000 Tonnen jährlich.
3. Fenne: Das Projekt, das nicht kommt
Parallel zum gefeierten Verso-Vertrag wurde das „HydroHub“-Projekt Fenne in Völklingen – vorher gefeiert als Startpunkt der heimischen Produktion von grünem Wasserstoff – still beerdigt[3]. Trotz eines Förderbescheids über 100 Millionen Euro und der Einstufung als „Important Project of Common European Interest“ (IPCEI) durch die EU, zog sich Betreiber Iqony zurück. Der Grund: kein Ankerkunde, keine wirtschaftliche Perspektive.
Dabei hatte der saarländische Wirtschaftsminister Barke das Projekt zuvor massiv beworben. Noch im Sommer 2024 betonte er, dass „die finanzielle Unterstützung durch Bund und Land entscheidend für die Realisierung einer umfassenden Wasserstoffwirtschaft ist, die das Saarland in eine wirtschaftlich erfolgreiche und nachhaltige Zukunft führen soll“[4].
Die Absage ist eine politische Niederlage – nicht nur für Barke, sondern für die gesamte saarländische Wasserstoffstrategie. Während Carling wächst, bleibt Fenne ein Mahnmal für die Grenzen der deutschen Energiewende.
4. Warum funktioniert Carling – und Fenne nicht?
Ein Elektrolyseur ist das Herzstück der Wasserstoffproduktion. Er spaltet Wasser mithilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff. Je nach Technologie benötigt er etwa 50–65 kWh Strom pro Kilogramm Wasserstoff. Damit ist Strom nicht nur Energiequelle, sondern Kostenfaktor Nummer eins: Rund 70–80 % der Produktionskosten entfallen auf die Stromversorgung.
Die Wirtschaftlichkeit eines Elektrolyseurs hängt maßgeblich von seiner Auslastung ab – also davon, wie viele Stunden pro Jahr er tatsächlich läuft. Je höher die Volllaststunden, desto besser verteilen sich die Fixkosten (CAPEX) auf die produzierte Menge Wasserstoff. Eine niedrige Auslastung führt zu höheren CAPEX pro kW, genau dies ist das Problem des Standorts Fenne. Der Grund liegt nicht allein in der Projektarchitektur, sondern im grundlegend unterschiedlichen Strommix zwischen Deutschland und Frankreich.
Während Frankreich dank des hohen Anteils an Kernenergie einen CO₂-armen Strommix vorweisen kann und so im Einklang mit EU-Vorgaben seine Elektrolyseure voll auslasten und dabei auf bestehende Erzeugungsanlagen zurückgreifen kann, ist Deutschland aufgrund der hohen Emissionsintensität seines Stromsektors gezwungen, neue und exklusive Erzeugungskapazitäten für Elektrolyseure bereitzustellen. Das bedeutet: Solar- und Windparks, die nicht nur errichtet, sondern auch zeitlich und geografisch mit der Elektrolyse korreliert betrieben werden müssen.
Die Folge: Fenne kann nicht rund um die Uhr laufen, sondern nur dann, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht – und das treibt die Kosten in die Höhe. Carling hingegen profitiert von einem stabilen, CO₂-armen Strommix, der eine kontinuierliche Versorgung erlaubt und damit die Wirtschaftlichkeit des Elektrolyseurs sichert. Nach Berechnungen des Autors würde in Fenne der Wasserstoffpreis ca. sieben Euro pro Kilogramm betragen, während er in Carling bei etwa viereinhalb Euro liegen würde – ein Unterschied, der über die Wettbewerbsfähigkeit entscheidet.
Fenne ist technisch ambitioniert, aber wirtschaftlich kaum tragfähig. Carling zeigt, wie regulatorische und systemische Rahmenbedingungen die Wirtschaftlichkeit eines Elektrolyseurs maßgeblich beeinflussen – und warum der Standort Deutschland derzeit strukturell im Nachteil ist. Hätte Deutschland in den letzten 20 Jahren seine Kernkraftwerke behalten, hätte es ähnliche Bedingungen wie in Frankreich schaffen können, aber dies wurde und wird politisch verhindert.
Und nun zeigt sich im internationalen Vergleich ein weiterer Schwachpunkt, der auch die Wirtschaftlichkeit der Wasserstofferzeugung in Carling relativiert.
5. Der Preisvergleich: Grüner Wasserstoff gegen Erdgas
Ein Kilogramm Wasserstoff enthält rund 33 Kilowattstunden Energie. Rechnet man die Produktionskosten auf diese Basis um, ergibt sich ein klares Bild: Der in Carling erzeugte Wasserstoff kommt auf etwa 135 Euro pro Megawattstunde, jener aus Fenne sogar auf rund 225 Euro. Damit liegen beide Varianten aber auch weit über dem Preisniveau fossiler Alternativen.
Zum Vergleich: Der aktuelle Marktpreis für europäisches Erdgas liegt bei etwa 35 Euro pro Megawattstunde. Rechnet man die CO₂-Kosten aus dem europäischen Emissionshandel hinzu – derzeit rund 80 Euro pro Tonne CO₂ – steigt der effektive Preis auf etwa 50 Euro pro Megawattstunde. Noch drastischer fällt der Unterschied im internationalen Maßstab aus: In den USA kostet Erdgas am Henry Hub lediglich 9 bis 10 Euro pro Megawattstunde.
Grüner Wasserstoff aus Deutschland ist damit mindestens dreimal so teuer wie fossiles Erdgas – und zwanzigmal so teuer wie US-Gas. Selbst Carling, das unter günstigen französischen Rahmenbedingungen produziert, liegt preislich über dem globalen Industriestandard. Die wirtschaftliche Realität ist eindeutig: Wasserstoff mag klimafreundlich sein, aber er ist derzeit kein wettbewerbsfähiger Energieträger für die Grundstoffindustrie.
6. Ein industriepolitischer Realitätscheck
Die Vision vom grünen Stahl mag politisch verführerisch sein – ökologisch sauber, technologisch fortschrittlich, wirtschaftlich transformativ. Doch die Realität ist ernüchternd: Die Produktion von grünem Wasserstoff in Deutschland ist strukturell teuer, regulatorisch überfrachtet und energetisch ineffizient. Selbst Vorzeigeprojekte wie Fenne scheitern nicht an mangelndem Willen, sondern an den physikalischen und ökonomischen Grenzen der deutschen Energiewende.
Frankreich zeigt mit Carling, dass es besser geht – aber auch dort bleibt grüner Wasserstoff ein teures Gut. Im internationalen Vergleich, insbesondere gegenüber US-Erdgas, ist er schlicht nicht konkurrenzfähig. Und solange das so bleibt, ist die Grundstoffindustrie in Deutschland auf Dauer nicht zu halten. Subventionen können Übergänge gestalten, aber sie ersetzen keine marktwirtschaftliche Tragfähigkeit.
Was bleibt, ist die Erkenntnis: Wer Industriepolitik ernst meint, muss sich der Kostenwahrheit stellen – und nicht nur der Klimarhetorik folgen.
Über den Autor:
Dr. Christoph Canne ist Pressesprecher und Mitglied des volkswirtschaftlichen Fachbereichs der Bundesinitiative VERNUNFTKRAFT e.V. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, fundierte Einschätzungen über die ökologischen, ökonomischen und technischen Zusammenhänge der Energiewende zu fördern und sachgerechte Lösungen zu entwickeln. Canne lebt im Saarland.
Quellen:
[1] Der Stahlschlag: Wie die Energiewende die Deindustrialisierung des Landes vorantreibt – Apollo News
[2]https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/stahlindustrie_wasserstoff_stahlholding_gruener_stahl_100.html
[3] SR.de: Vorerst keine Wasserstoff-Fabrik im Kraftwerk Fenne
[4] Förderbescheid für Wasserstoffprojekt „HydroHub Fenne“ in Völklingen übergeben | saarnews
Die Kolumne spiegelt nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.