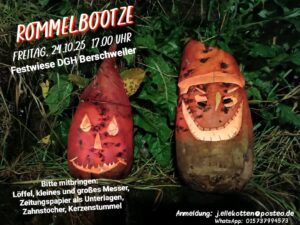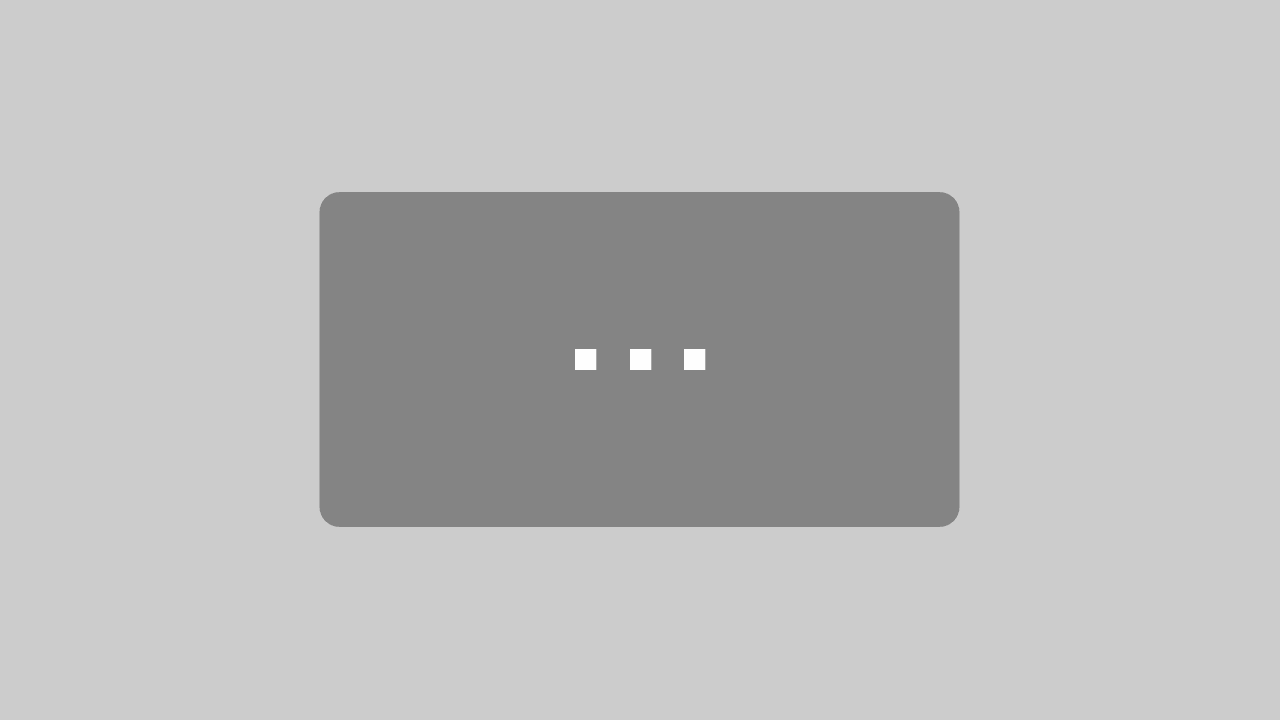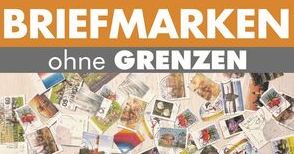In Deutschland lag die Inflationsrate im Monat Mai 2022 bei 7,9 Prozent und erreichte damit den Höchstwert seit Anfang der Achtziger Jahre. Im Monat Juni sank die Inflation auf 7,6 Prozent. Diese Reduktion ließ sich jedoch vordergründig auf Sondereffekte zurückzuführen (z. B. Tankrabatt, 9-Euro-Ticket). Im Monat Mai lag die Inflationsrate im Saarland bei 7,2 Prozentpunkten.
Im Jahr 2021 hat die Europäische Zentralbank (EZB) ein mittelfristiges Inflationsziel von 2 Prozent definiert. Bei dem 2 Prozent Inflationsziel stehen ein gesundes Wirtschaftswachstum und eine stabile Preisentwicklung in einem gesunden Verhältnis zueinander.
Mit Blick auf die aktuellen Inflationsraten ist dieses Ziel in weite Ferne gerückt. Die zentralen Treiber hinter dieser hohen Teuerungsrate und dem Verfehlen des Inflationsziels sind vielfältig wie offensichtlich: Der Angriffskrieg auf die Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe springen. Doch nicht nur die Preise im Energiebereich sind von einem enormen Anstieg betroffen, sondern beispielsweise auch die Preise von Metallen, Getreide oder Düngemittel. Die weltweiten Schwierigkeiten in den Lieferketten verbunden mit der Warenverknappung führen ebenfalls dazu, dass die Produktpreise und damit die Inflationsrate weiter nach oben ansteigen. Die Mängelzustände in bestimmten Segmenten (z. B. Baustoffe) reduzieren deren Verfügbarkeiten und erhöhen damit die Preise. Chinas Null-Covid-Strategie ergänzt diese Entwicklung, da essenzielle Logistikpunkte geschlossen und damit Lieferprozesse verzögert werden.
Doch bei all diesen Entwicklungen stellt sich die Frage, was Inflation überhaupt ist, wie sie entsteht und was Regierungen bzw. Zentralbanken dagegen tun können.
Der Begriff Inflation leitet sich aus dem Lateinischen „inflatio“ ab, der übersetzt aufblähen bzw. aufblasen bedeutet. Um die Inflation zu verstehen, stelle man sich einen Warenkorb vor. Mit diesem Warenkorb läuft man nun gedanklich durch ein Geschäft und packt verschiedene Produkte ein. Das sind beispielsweise Lebensmittel, Pflegeprodukte, Kleidung oder Haushaltszubehör. Diesem Warenkorb werden weitere Produkte und Dienstleistungen hinzugefügt, die wir in unserem Alltag benötigen. Hierzu zählen z. B. Strom, Gas, Öl, Benzin oder Freizeitausgaben wie Kinokarten oder Schwimmbadtickets. Nachdem der Einkauf abgeschlossen ist, wird einem an der gedanklichen Kasse ein Preis für den gesamten Warenkorb genannt. Dieser Preis des heutigen Warenkorbs wird mit dem Preis des gleichen Warenkorbs vor einem Jahr verglichen. Rein fiktives Beispiel: Kostete der Warenkorb vor einem Jahr 50 Euro und heute 55 Euro, so hätten wir eine Inflationsrate von 10 Prozent.
Ist nun eine Zeit wie die aktuelle gekommen, stellt sich die Frage nach möglichen Gegenmaßnahmen. Staaten und den zugehörigen Zentralbanken stehen einzelne Maßnahmen zur Verfügung, deren Wirksamkeit natürlich sehr von den vorhandenen Rahmenbedingungen abhängt. Zentralbanken werden von einem oder mehrerer Staaten errichtet, um die Geld- und Währungspolitik mitzugestalten. Eine Maßnahme gegen eine zu hohe Inflation liegt in der stufenweisen Erhöhung der Zinsen und der Reduktion von Anleihekäufe. Die EZB hat in einer Sitzung im Monat Juni in Amsterdam angekündigt, die Anleihekäufe zum 01.07.2022 zu beenden. Am 21.07.2022 hat die EZB die
Zinswende eingeläutet und die Zinsen nach elf Jahren erstmals wieder um 0,5 Prozent erhöht. Mit erhöhten Zinsen werden Kredite teurer, weshalb deren Nachfrage vergleichsweise sinkt. Dadurch reduziert sich die verfügbare Geldmenge, wodurch der Euro wieder mehr wert wird. Der Staat kann mit einer restriktiven Ausgabenpolitik versuchen, die Inflationsrate zu minimieren. Bei einer restriktiven Geldpolitik wird die im Umlauf befindliche Geldmenge reduziert, indem bspw. Subventionen gesenkt werden. Der Staat greift bei einer zu hohen Inflation je nach Branche zu Steuersenkungen, wie beispielsweise bei der Energiesteuer. Dieser Schritt ist jedoch kritisch genau zu beäugen, da solche Steuersenkungen für den Staat teuer sind und der Entlastungseffekt beim Endverbraucher nicht immer ankommt.
Es gibt noch vereinzelt andere Maßnahmen, die von staatlicher Seite gegen zu hohe Inflationsraten eingesetzt werden können. Klar ist jedoch: Eine derartige Inflation lässt sich nicht von heute auf morgen „heilen“. Die jetzige ist eine importierte Inflation, die insbesondere durch die angezogenen Energiepreise und die Lieferkettenproblematik ansteigt. Der staatliche Handlungsspielraum, um diese zu regulieren, ist daher eher beschränkt. Es ist aktuell eine Phase des Durchhaltens und bestmöglichen Anpassens an die Situation. Finden Produktions- und Logistikprozesse wieder ihren normalen Weg und reduziert sich die Energieknappheit, können sich die Wolken am dunklen Inflationshorizont langsam wieder lichten.