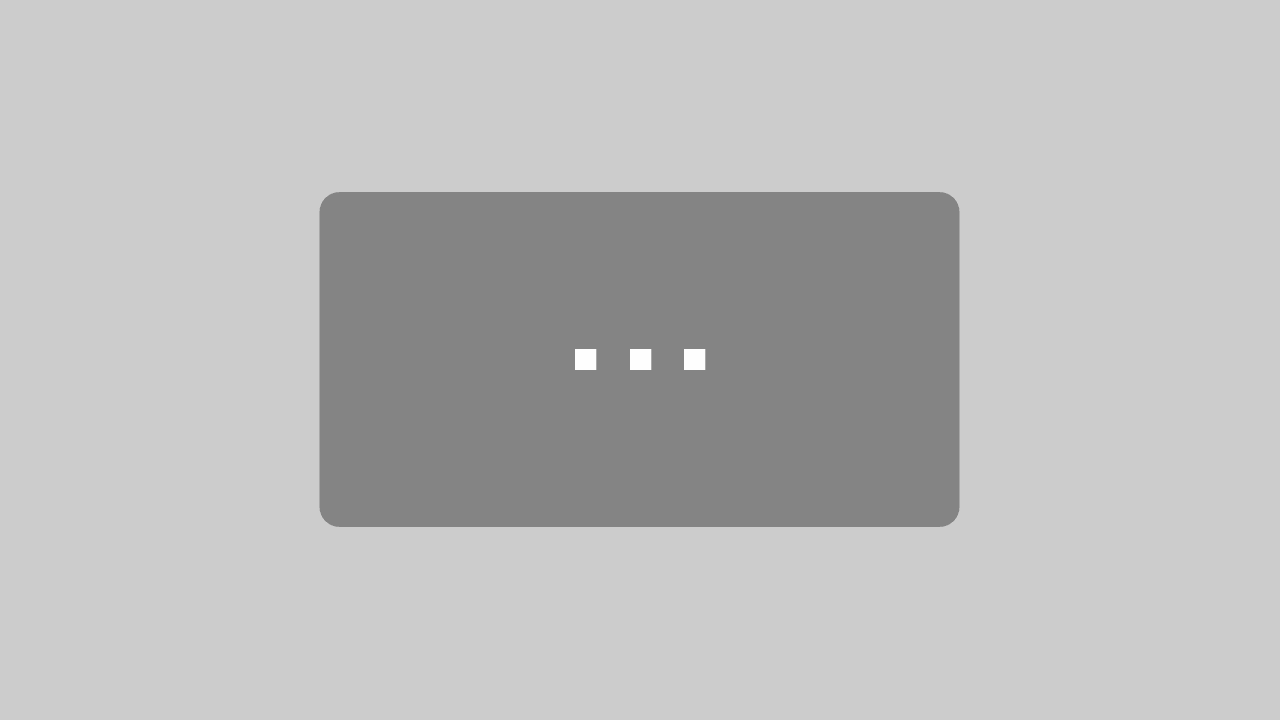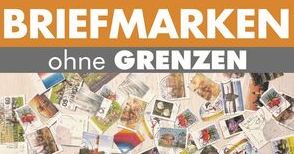Subventionen sind ein heiß diskutiertes Thema. Die einen bezeichnen sie als willkürliche Zahlungen an Unternehmen, die anderen sehen in ihnen konjunkturelle Anschubfinanzierungen für die Zukunftssicherung eines Standortes. Zusätzlichen Nährboden zum Diskurs bieten die teilweise schwindelerregenden Subventionssummen, die als Unterstützungsleistungen gewährt werden.
In Sachen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg soll die Errichtung der Halbleiterproduktion des Unternehmens Intel mit zehn Milliarden Euro subventioniert werden. In Dresden steht für das Werk des taiwanesischen Halbleiterherstellers TSMC eine Förderung von fünf Milliarden Euro im Raum. Auch bei uns im Saarland werden Subventionen mit dem Ziel der wirtschaftlichen Entwicklung und der Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandorts gezahlt. Das Unternehmen Wolfsspeed hat für die Herstellung ihrer Siliziumkarbid-Chips am geplanten Standort in Ensdorf bisher die Zusage von Bund und Land für Subventionen in Höhe von 515 Millionen Euro erhalten. Bei dieser Summe sind die Mittel noch nicht eingerechnet, die dem Unternehmen aus dem „European Chips Act“ möglicherweise noch zur Verfügung gestellt werden. Für die geplante Ansiedlung der Batteriefabrik von SVOLT und für die „Revitalisierung“ des Ford-Geländes in Saarlouis sind ebenfalls Subventionszahlungen geplant. Die Stahl-Holding-Saar (SHS) hat Ende letzten Jahres die Zusage für Subventionen in Höhe von 2,6 Mrd. Euro erhalten, welche die Umstellung der Produktion auf grünen Stahl unterstützen soll.
Mit Blick auf diese Fallbeispiele tut sich die Frage auf, womit solche großen Subventionssummen zu rechtfertigen sind. Zunächst ist der Blick auf einzelne „Antithesen“ zu richten: Wird versucht, mit Subventionen rückwärtsgewandte Technologien künstlich am Leben zu halten, sollte ein großes Fragezeichen hinter die Zahlungen gesetzt werden. Als Überbrückungszeit kann dies zweckdienlich und vor allem sozialverträglich sein, nicht aber langfristig. Subventionen machen auch dann keinen Sinn, wenn der einzelwirtschaftliche Nutzen des Unternehmens durch bürokratische Prozesse und Antragserfordernisse aufgewogen werden und letztlich nur Ressourcen verbraucht werden. Kritiker sehen bei Subventionen zusätzliche Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen infolge der Stärkung einzelner Großunternehmen.

Bei aller Kritik gibt es ein wesentliches Argument für die Gewährung von Subventionen an die Wirtschaft: Subventionszahlungen können sich langfristig als echte Rendite für eine Region erweisen. Unternehmen investieren über die eigentliche Subventionssumme hinausgehend Geld an einem Standort. Auf Basis einer klugen Standortinvestition entsteht also eine Verzinsung der Subventionen, unter anderem über die folgenden Steuereinnahmen und die gestärkte Kaufkraft. Das ist ein wirtschaftlicher Aspekt, der keineswegs zu unterschätzen ist. Als Wirtschaftsförderung hier vor Ort ist es uns ein Anliegen, dass Subventionen und Förderprogramme auch den kleinen und mittleren Unternehmen zur Verfügung stehen.
Der weltweite Standortwettbewerb ist inzwischen sehr intensiv geworden, was die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit von Deutschland auf die Probe stellt. Ein gewisser Zugzwang zur Subventionsgewährung lässt sich daher nur schwer verneinen. Darüber kann nun Trübsal geblasen oder der Blick nach vorne gerichtet werden: Kluge Subventionen in zukunftsgerichtete Geschäftsmodelle haben die Kraft, Innovationen zu fördern, Transformationsprozesse zu unterstützen, Arbeitsplätze langfristig zu sichern und gleichzeitig deren Entwicklungspotenzial zu heben.