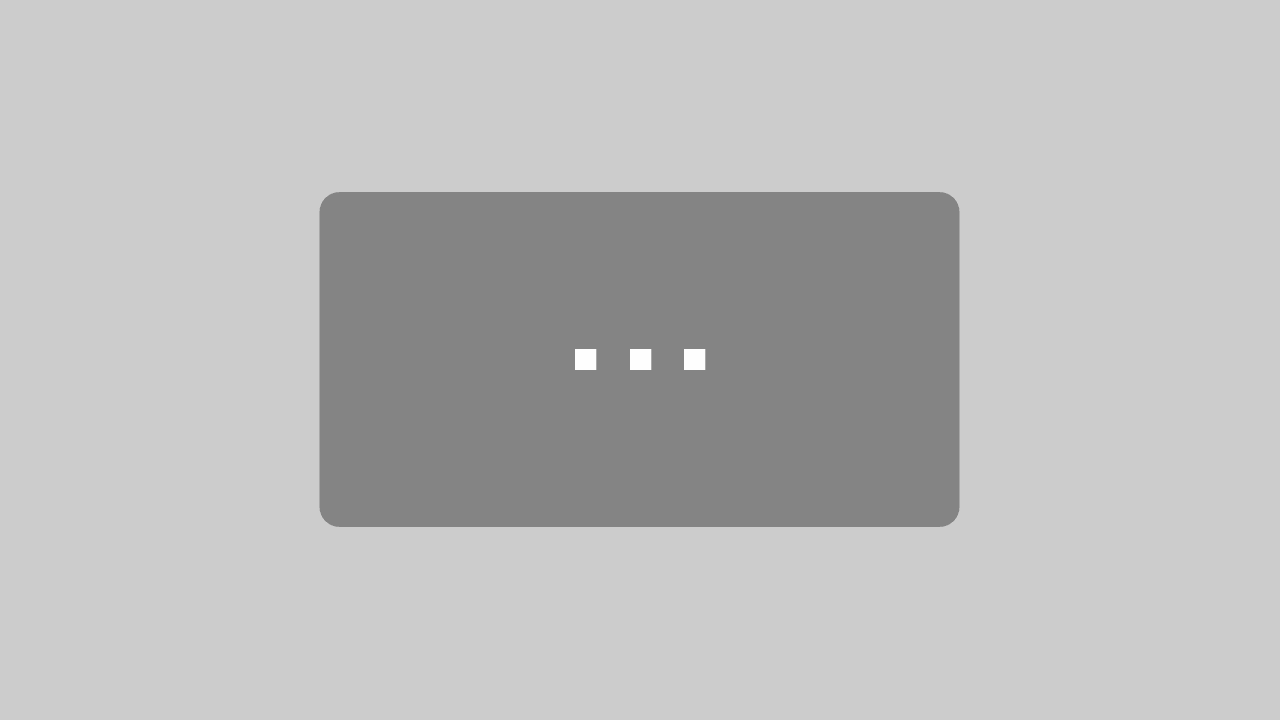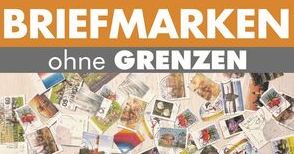Jeden Samstagmorgen um 11 Uhr findet in St. Wendel eine Stadtführung statt – sofern sich mindestens zwei Leute einfinden, um daran teilzunehmen. Als ich am 19. Juli 2025 zum Dom komme, wartet Frau Merckel von der Touristinfo auf mich. Sie fragt, ob zwei Amerikaner bei der Führung mitgehen können. Sie hatten gestern die Touristinfo besucht, und Frau Brönstrup hat sie auf die Stadtführung hingewiesen.

Moses Gerber dahinter in deutscher Uniform
aufgenommen vermutlich in Mannheim 1914-1919
Nur wenn sie ausreichend Deutsch verstehen, entgegne ich. Ich kann sehr wohl auch auf Englisch führen, aber in Deutsch und Englisch zusammen, das zieht sich extrem in die Länge und ist unbefriedigend für beide Parteien. Die beiden Amerikaner verstehen gut Deutsch, versichert mir Frau Merckel.
So treffe ich Ronit und Ofer Ben-Amots. Die beiden sehen nicht wie typische Amerikaner aus, und ihren Akzent kann ich gar nicht einordnen. Dieses Rätsel löst sich schnell, als Ronit mir einen Plan von St. Wendel zeigt, der nur die Innenstadt zeigt. Zwei Koordinatensysteme sind zu sehen – Großbuchstaben zeigen Breiten-, Zahlen Längengrade.
Ronit sagt mir, ihr Großvater habe gesagt, er habe in St. Wendel in „H 12“ gewohnt. Hm – „H“, das bedeckt die Innenstadt, aber 12 ist irgendwo viel weiter südlich, ggf. Niederlinxweiler.
Wann ihre Vorfahren aus St. Wendel ausgewandert seien, frage ich. Die Antwort macht mich stutzig: „1935“. Und der Name? „Gerber“, sagt sie, und fügt hinzu: „Sie waren Juden!“
Als ich die linke Augenbraue hochziehe, wäre Mr. Spock stolz auf mich gewesen.
„Gerber“ – der Name sagt mir etwas, aber dazu brauche ich meinen Computer. Die Turmuhr schlägt, und die Stadtführung beginnt. Auch die anderen Gäste sind nicht unbedingt von hier, also versuche ich mich in meiner Spezialmischung aus Platt und Hochdeutsch, sprich: ich bemühe mich.
Ich gehe meinen Sommerweg – zum Rathaus, wo die Zerstörung der Stadt das Thema ist, die Schloßstraße hinunter zu Eugen Berl und weiter zum ehemaligen Rathaus, den Coburgern und der Herzogin Luise. Das Stenzengäßchen hinauf zum Dom und um den herum und hinein.
Die Leute sind gut dabei und lachen, wenn sie lachen sollen, so belohne ich sie mit einem Besuch der Orgelempore, und wenn wir schon mal hier sind, geht’s auch hinauf auf den Turm.
Hier scheiden sich die Geister doch sehr, denn die meisten erweisen sich als nicht schwindelfrei – die Glocken besuchen sie noch, aber auf den Balkon unter der großen Uhr trauen sich nur zwei Gäste.
Um kurz vor zwei ist die Führung zu Ende – Ronit und Ofer sind die ganze Zeit dabeigeblieben. Ich hoffe nur, sie sind mitgekommen. Ich verabrede mich mit ihnen für 15 Uhr und fahre nach Hause, um meine Datenbanken zu konsultieren.
Spurensuche beginnt
Als ich sie um 15 Uhr in der Kelsweilerstraße einsammele, frage ich sie, ob ihr Großvater Jakob Gerber 1911 geboren sei. Ihr Gesichtsausdruck spricht Bände.
Damals
Anna Gerber ist verzweifelt. Vier Kinder hat sie geboren, und zwei sind gestorben, kaum dass sie laufen konnten. David, geboren 1908, und Jakob, geboren 1911, geht es gut – aber wenn der Herr ihr die beiden auch noch nimmt …
Ihr Ehemann Moses beschließt, mit dem Rabbi der Gemeinde zu sprechen. Dessen Rat erscheint ihnen seltsam, aber sie beschließen, ihn zu befolgen. Der Rabbi hat nämlich gesagt, sie müssten ihre Heimat Galizien verlassen und nach Deutschland ziehen.
Galizien gibt es schon lange nicht mehr. Sein Gebiet lag im Süden Polens und im Westen der Ukraine. Eigentlich gehörte es zu Polen, aber nach dessen erster Teilung 1772 kam es an das österreichische Haus Habsburg. Als Königreich Galizien und Lodomerien wurde die Landschaft 1804 dem Kaisertum Österreich angegliedert und blieb bis 1918 bei Österreich-Ungarn.
Geheiratet haben Anna und Moses am 16. Dezember 1902 in der Stadt Komarno.
St. Wendel hat zwischen 1793 und 1974 zwölfmal die Zugehörigkeit gewechselt. Aus Wikipedia stammt diese Übersicht, wohin Komarno wann gehörte:
Die Ortschaft wurde 1324 zum ersten Mal schriftlich erwähnt und erhielt 1473 das Magdeburger Stadtrecht. Die Stadt gehörte von 1774 bis 1918 zum österreichischen Galizien und war von 1854 bis 1867 Sitz der Bezirkshauptmannschaft Komarno, danach wurde ein Bezirksgericht des Bezirks Rudki errichtet.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kam der Ort zur Westukrainischen Volksrepublik, anschließend an Polen, wurde im Zweiten Weltkrieg kurzzeitig von der Sowjetunion und dann bis 1944 von Deutschland besetzt.
Nach dem Ende des Krieges wurde die Stadt der Sowjetunion zugeschlagen, dort kam sie zur Ukrainischen SSR. Seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 ist sie ein Teil der unabhängigen Ukraine. Bis zum 24. März 1992 trug die Ortschaft den offiziellen Namen Komarne und wurde dann auf den heutigen Namen umbenannt.
Im Ort gibt es eine alte katholische Kirche sowie eine orthodoxe Kirche.
Von Galizien nach Deutschland
Anna und Moses wurden beide 1877 in Chłopy geboren, einem der 21 Dörfer im Rajon Lwiw. David kam in Vybranivka zur Welt, ca. 15 km südlich von Lwiw, sein Bruder Jakob in Malyniw, ein paar Kilometer westlich. Leider liegen mir keine Geburtsunterlagen vor, sodass ich die Lokalitäten pi mal Daumen schätzen musste.
Die Familie verkaufte ihr Hab und Gut und machte sich mit ihren Kindern auf den 1400 km langen Weg. In der jüdischen Gemeinde der Stadt Mannheim fanden sie ab 1914 ihr neues Zuhause.
Ihre beiden Söhne besuchten die Volksschule K5, die seit 1969 Johannes-Kepler-Schule genannt und heute noch als Grund- und Hauptschule genutzt wird. Unbestätigten Quellen zufolge diente Moses im Ersten Weltkrieg und erhielt das Eiserne Kreuz. Aus dem Krieg zurück arbeitete er erst als Tagelöhner, später als Altwarenhändler.
Seinen vermutlichen Traum als Besitzer eines Bauernhofs konnte er in Mannheim schlecht verwirklichen, aber wohl im entfernten Saargebiet. Das war nach dem Ersten Weltkrieg vom Deutschen Reich abgetrennt worden und unterstand seit 1920 dem Völkerbund. Verwaltet wurde es von einer vom Völkerbund eingesetzten Regierungskommission. Das Saargebiet gehörte weder zu Deutschland noch zu Frankreich, doch beide Staaten bemühten sich um großen Einfluss – wirtschaftlich, politisch und kulturell.
Ein Bauernhof in Alsfassen
Dorthin zog Familie Gerber und kaufte in St. Wendel an der Straße nach Bliesen, ausgangs Alsfassen, einen kleinen Bauernhof. In Alsfassen gab es noch keine offiziellen Straßenbezeichnungen, weshalb die heutige Alsfassener Straße 80 damals die Hausnummer „Alsfassen 29“ trug.
Errichtet wurde das Anwesen in den 1860ern von dem Bauunternehmer Peter Zeyer (1853–1924) und seiner Ehefrau Katharina Krämer (1859–1916), die das notwendige Grundstück von Peters verwitweter Mutter Elisabeth Zeyer, geb. Gregorius (1810–1887), erhalten hatten.
1914 geriet das Zeyersche Bauunternehmen in Konkurs, weshalb im September das ganze Anwesen – bestehend in rund 40 Morgen Ackerland, Wiesen und Steinbruch, nebst Wohnhaus Nr. 29 am Lanzenberg mit Ökonomiegebäuden – zwangsversteigert wurde. Da Zwangsversteigerungen nicht über den Notar laufen, gibt es dazu dort keine Akten.
Alsfassener Straße 80 ist das Haus in der Mitte mit dem großen Scheunentor.
Die Aufnahme ist ein Detail einer größeren aus den 1920ern (grobe Schätzung), aufgenommen von der Wiese zwischen Straße und dem hinter dem Fotografen vorbeilaufenden Johannesbach.
Ein paar Jahre später wurde ein zweites Foto aufgenommen. Der Baum an der Straße gegenüber des Hauses ist ein ganzes Stück gewachsen. Das alte Scheunentor zur Straße ist zugemauert bzw. durch ein Fenster ersetzt worden.
Im April 1927 zog der Landwirt Karl Biesenbach mit seiner Ehefrau Else Schramm und Sohn Karl Heinz nach St. Wendel. Am 18. November desselben Jahres verkaufte ein gleichnamiger Karl Biesenbach, Verwaltungsamtmann in Neunkirchen, Prinz-Heinrichstraße 78, für 22.750 Reichsmark das Haus an Moses’ Ehefrau Anna Gerber, geborene Segal [Notar Jochem, Nr. 1619 vom 18.11.1927], und eine Woche später zogen die Biesenbachs nach Neunkirchen um.
Ob der Verwaltungsamtmann und der Landwirt die gleiche Person sind oder wie sie miteinander verwandt sind, ist mir unbekannt, ebenso, warum Anna die Käuferin war und nicht ihr Ehemann.
Käufe und Verkäufe
Eine andere Frage, die sich stellt – und nicht beantwortet werden kann –, ist, wie die Gerbers erfahren haben, dass hier in St. Wendel ein Bauernhof zur Disposition steht.
Jedenfalls trugen die Gerbers auf ihre Grundstücke zugunsten des Verwaltungsamtmanns Karl Biesenbach in Neunkirchen-Saar eine Hypothek ein, die 1928 an den Kaufmann Erwin Biesenbach in Forsten bei Cürten abgetreten und im Dezember 1930 auf drei Äcker in der St. Wendeler Gemarkung „bei Patrollseich“ eingetragen wurde. [Notar Jochem, Nr. 1591 vom 02.12.1930]
In Notar Jochems Notariatsakten der Endzwanziger Jahre finden sich einige Verträge, mit denen die Gerbers (meist Anna Segal) Grundstücke kauften und verkauften. Das begann am 31. Mai 1928 mit einer Wiese im Gründchen, Flur 22 Nr. 277, Wiese, 3,39 ar.
Das Gründchen ist natürlich nicht die Straße, sondern der lange und recht tiefe Hang unterhalb der Straße zur Alsfassener Straße hin, links und rechts flankiert von der Saarbrücker Straße und dem Falkenbösch. Ankäufer war der Schlosser Anton Schaadt, dem man einige Erfindungen nachsagt, u. a. eine Kohlenschippe mit einem Drücker dran, wie man ihn von Tortenschaufeln kennt, mit denen der weiche Kuchen nicht durch leichte Ruckelbewegungen auf den Teller geschoben wird, sondern durch eben einen kleinen Drücker.
Bei den Kohlenschippen war das praktisch, weil die Herdöffnungen, durch die die Kohle musste, recht eng waren und bei herkömmlichen Schippen immer wieder Kohle runterfiel.
Schaadt baute auf die Parzelle, die unmittelbar an der Landstraße und dem Johannesbach liegt, das heutige Haus Alsfassener Straße 43, das seit vielen Jahren dort vor sich hingammelt. [Notar Jochem, Nr. 903 vom 31.05.1928]
Grundstücke, Wiesen, Äcker – und ein Gestaltwandel
Am 21. August 1928 kaufte Anna Segal von dem pensionierten Bergmann Johann Klos aus Alsfassen und dessen Ehefrau Anna Wagner eine Wiese am Unterweg unter der Breschbach (Flur 24 Nr. 488/151, 15,41 ar) [Notar Jochem, Nr. 1208 vom 21.08.1928].
Die Breschbach ist der St. Annenbach, der aus Cettos Weiher – ziemlich weit oben im heutigen Golfplatz – kommt, ziemlich gerade denselben durchquert, unter der B41 durch ein langes Rohr fließt und dahinter wieder ziemlich gerade seinen Weg nimmt. Nicht weit vom Hütherhof mündet er in den Johannesbach.
Letzterer, den ich eigentlich nur als „Johannesbach“ kenne, kommt von Winterbach her durch die Weiher, die man die „Tankfallen“ nennt – in den 1930ern als Verlängerung der Höckerlinie über die Landstraße nach Bliesen angelegt.
Der Unterweg ist das Stück Landstraße etwa von der Saarbrücker Straße bis zur B41 – pi mal Daumen. Am Unterweg unter der Breschbach ist das Gebiet zwischen Landstraße, Saarbrücker Straße und der Straße am Hütherhof hinauf auf die Acht (sprich: zur B41). Die Parzelle 151 liegt mittendrin. Sie ist vier-, aber nicht rechteckig; ihr kurzes Ende bildet der St. Annenbach.
Am gleichen Tag erwarb Anna Segal zwei Äcker am Gebebruch – der liegt mitten im Golfplatz. Hinter dem Golfhotel geht der Rundweg in einer langen Linkskurve durch ein Tälchen – das ist der Gebebruch. Verkäuferin: Margareta Zimmermann, Ehefrau des Weichenstellers Peter Lambert in Alsfassen. [Notar Jochem, Nr. 1209 vom 21.08.1928]
Verkäufe im Gründchen – Moses taucht auf
Im Februar des darauffolgenden Jahres verkauften die Gerbers zwei Stücker im Gründchen. Diesmal verkaufte nicht nur Anna Segal, sondern „Moses Gerber und seine Ehefrau Anna Segal“ – was witzig ist, weil Moses Gerber in St. Wendel nie etwas gekauft hat, rein rechtlich gesehen.
Der Postschaffner Peter August Brill aus Winterbach und seine Ehefrau Paula Lück erwarben in Flur 22 die Parzellen 1678/269 und 1681/269 – das sind eine Wiese und ein Hofraum. Diese beiden kleinen Stücker liegen unmittelbar hinter Alsfassener Straße 43. Was dann einen Sinn ergibt, wenn man weiß, dass der schon genannte Anton Schaadt die im Mai erworbene Parzelle 277 und zwei weitere mit der Endnummer 269 an das Ehepaar verkauft hatte.
Jetzt frage ich mich nur, ob es wirklich Schaadt war, der das Haus damals baute. [Notar Jochem, Nr. 259 vom 20.02.1929]
Der letzte Vertrag in dieser Reihe ist wieder ein Kauf: Der Oberweichenwärter Wilhelm Gregorius in Alsfassen und seine Ehefrau Maria Brill verkauften an Anna Segal Flur 24 Nr. 589/169 – Hofraum im Gründchen; das war eine kleine Parzelle direkt bei ihnen am Haus. [Notar Jochem, Nr. 859 vom 01.08.1933]
Die Saarabstimmung und ihre Konsequenzen
15 Jahre nach Kriegsende – am 13. Januar 1935 – sollte die Bevölkerung des Saargebiets im Rahmen einer Volksabstimmung entscheiden: Angliederung an Frankreich, Rückgliederung an Deutschland oder Beibehaltung der Völkerbundverwaltung bzw. Status quo.
Das Ergebnis: Über 90 Prozent der Abstimmungsberechtigten votierten bei einer Wahlbeteiligung von 97 Prozent für die Rückkehr nach Deutschland – nach Hitler-Deutschland!
Aber alle Warnungen und auch die Schilderungen tausender Emigranten, die ab 1933 aus dem Reich ins Saarland gekommen waren, wurden von der Saargebietspresse – Saarbrücker Zeitung oder die Saarbrücker Landeszeitung – totgeschwiegen oder beschönigt.
Die Angst insbesondere von Juden, Kommunisten und Sozialdemokraten, mit der Rückgliederung zu Deutschland um ihr Leben fürchten zu müssen, erreichte die öffentliche Meinung nicht – und dürfte den meisten auch gleichgültig gewesen sein.
[Quelle: gedenkbuch.saarbruecken.de]
Das Römische Abkommen von 1934 sicherte allen Bewohnern des Saargebiets, die am 3. Dezember 1934 dort gemeldet waren, bis zum 29. Februar 1936 eine Nicht-Schlechterstellung wegen ihrer Sprache, Rasse oder Religion zu.
Das erleichterte Juden und allen anderen Gegnern des Nazi-Regimes die Emigration ins Ausland. Sie konnten mit ihrem gesamten Vermögen ohne Angabe von Gründen auswandern – allerdings mussten viele ihr Eigentum unter Wert verkaufen.
Der Abschied aus Deutschland
Als die Gerbers nach der Saarabstimmung im Januar 1935 beschlossen, Deutschland den Rücken zu kehren, verkaufte Anna als alleinige Eigentümerin am 29. März alle Grundstücke samt Gebäude (Grundbuch St. Wendel, Blatt 2053) zum Preis von 16.000 Reichsmark – alles tote und lebende Inventar sowie alle Futter- und sonstige Vorräte für 7000 Reichsmark.
Allerdings standen noch Forderungen von 7736,50 RM aus, sodass 10.599,62 RM sofort zahlbar waren – und nach den Regeln des Römischen Jahres auch ausgezahlt wurden. Auch die noch eingetragenen drei Hypotheken von 2199,04 RM, 1625,97 RM und 838,87 RM waren im Vertrag enthalten.
Neue Eigentümer wurden der Landwirt Erich Wolf aus Bübingen bei Saarbrücken und seine Ehefrau Hedwig Huppert; sie zogen am 9. April 1935 ein. Wolf blieb indes auch nicht lange, sondern zog 1941 nach Hayingen in Lothringen, wo er ein paar Jahre später gestorben ist.
Das Anwesen verkaufte er kurz vor Ende des Krieges an den Landwirt Johann Aatz und seine Ehefrau Anna Boesen. Deren Sohn Erich Aatz hat mir erzählt, dass er das Wohnhaus in den 1970ern neu baute:
Erst riss er links den Stall ab und errichtete ihn als Wohnteil neu; dann wurde der alte Wohnteil rechts niedergelegt und erneuert.
Als ich 1988 einen Rundflug von Marpingen aus unternahm und Fotos von Alsfassen schoss, war der Umbau schon erfolgt. Sorry für die Unschärfe – aber ich hatte den Teil Alsfassens leider nicht wirklich im Fokus.
Abschied nach Palästina
Moses und Anna Gerber wohnten bis zu ihrer Abreise nach Palästina vermutlich in Miete bei Katharina Lißmann in der Hospitalstraße 30. Am 19. Juni 1935 verließen sie St. Wendel und wanderten nach Palästina aus.
Die Söhne bleiben zurück
Ihre beiden Söhne blieben in Deutschland zurück.
David wohnte in der Balduinstraße 37. Das Haus stand unmittelbar unterhalb Balduinstraße 39 (Bäckerei Thelen), war also ursprünglich das letzte Haus in der Stadt vor der Stadtmauer. Dort wohnte 1933 auch der jüdische Kaufmann Hermann Singer (1893–1971) mit seiner Ehefrau Erna Ettel Danczes (1897–1951), die aus dem bereits erwähnten Komarno stammte. Das Ehepaar hatte vier Kinder, die zwischen 1921 und 1927 in St. Wendel geboren wurden.
Das ist die heutige ehemalige Bäckerei Thelen, zur Zeit der Aufnahme um die Wende ins 20. Jahrhundert.
Das Haus Balduinstraße 37 ist das kleine, das sich direkt links von „Thelen“ zu verstecken scheint.
David heiratete am 24. März 1936 Chawa (Klara) Kilik. Sie war am 8. September 1930 nach St. Wendel gekommen und arbeitete auf dem Hof in Alsfassen als „Stütze“, wie man damals eine Haushaltshilfe nannte.
In seiner Entschädigungsakte (Landesarchiv Saarbrücken, LEA 8724) erinnert sich Davids Bruder Jakob 1957 an ihn und Klara:
„Meine Eltern beschäftigten auf ihrem Gut außer mir noch meinen Bruder David Gerber, meine Cousine Klara Killig und einen Arbeiter regelmäßig. Außerdem waren in der Saison bis zu zehn Hilfsarbeiter auf dem Gut tätig. Hätte ich nicht auf dem Gut meinen Eltern geholfen, so wäre an meiner Stelle eine andere Kraft nötig gewesen.“
Klara war tatsächlich eine Cousine der beiden Brüder. Sie war am 22. Dezember 1910 nicht weit von ihnen in Galizien zur Welt gekommen. Ihre Eltern waren Kalmann Kilik und seine Ehefrau Sebor Segal, vermutlich eine Schwester von Moses Gerbers Ehefrau Anna Segal.
Der „regelmäßige Arbeiter“ war ein Tagelöhner namens Albert Hofer, der zusammen mit ihr auf dem Hof anfing.
Jakob zwischen den Welten
„Von 1927 bis 1935 war ich auf diesem Gut meiner Eltern anhaltend beschäftigt“, schreibt Jakob. „Ich hatte freie Kost, Logie und Bekleidung und einen monatlichen Verdienst von ca. 200 bis 250 Francs. Das war keine Bezahlung, sondern lediglich das Taschengeld. Ein Fremdarbeiter verdiente seinerzeit neben Kost und Logie 15 französische Francs pro Tag.“
Jakobs Meldekarte im St. Wendeler Ordnungsamt deckt sich nicht ganz mit seinen Erinnerungen:
-
8. November 1927: Jakob kommt von Mannheim nach St. Wendel, wo er fünf Jahre gemeldet ist.
-
23. Mai 1932: Umzug nach Frankfurt – kehrt nach weniger als vier Wochen wieder zurück.
-
18. Juni 1932: Zieht in das Haus Hospitalstraße 32.
Dort wohnte ein anderer jüdischer Landwirt namens Isaac Lehmann (geb. 1861 in Lengfeld), mit seiner Ehefrau Riele Rosa Hess (1869–1934). Sie waren von Darmstadt nach St. Wendel gekommen.
Erst wohnten sie in Kelsweilerstraße 27, dann in Balduinstraße 18 und Brühlstraße 21 zur Miete, bevor sie 1917 das Haus Hospitalstraße 32 kauften.
Seine Frau starb 1934 in St. Wendel. Auf dem Friedhof in Urweiler – drei Gräber links des Eingangs – steht ihr verwitterter Grabstein. Dort sind auch die Namen ihrer beiden Töchter Thekla Sara (1897–1942) und Flora Maria (1907–1943) verzeichnet – sie wurden am 12. Februar 1936 nicht nach Palästina ausgewandert und später in Piaski und Auschwitz ermordet.
Hospitalstraße 32 wird zur Marienstraße
Aber welches Haus ist „Hospitalstraße 32“?
Es müsste das erste Haus linkerhand sein, wenn man von der Marienstraße einbiegt. Das trägt aber heute die Hausnummer 30. Seit 1935 hat sich hier einiges verändert. Die heutige Nummer 30 wurde etwas erhöht, Nummer 28 (rechts) hat zwei Gauben mehr. Heute steht links von „30“ eine Garage, 1935 stand dort nichts.
Wo also ist „32“ geblieben?
Als Isaac Lehmann das Haus 1917 von Franz Gräber erwarb, wurde es so beschrieben:
„Flur 6 Nr. 765/232 – St. Wendel, Hospitalstraße 32 – Wohnhaus mit Stall und Hofraum“
[Notar Custodis, Nr. 774 vom 27.06.1917]
Als die Preußen 1843 mit der Uraufnahme begannen, legten sie größere Bereiche an, die sie Fluren nannten, und zählten die Parzellen darin von 1 bis x durch. Änderungen nach dieser Aufnahme wurden als neue Parzellen „auf Basis von …“ nummeriert.
Das heutige Anwesen Marienstraße 3 basiert auf Nr. 232. Durch eine Änderung wurde daraus „765/232“.
Bis 1939 existierte die Marienstraße in ihrer heutigen Form noch nicht. Auf einem Plan von 1910 sehen wir:
-
Die Hospitalstraße begann unten an der Luisenstraße.
-
Führte den Berg hinauf.
-
Knickte oben nach rechts ab.
-
Endete an der Balduinstraße.
Dementsprechend waren die beiden Häuser rechterhand nach dem Knick als „Hospitalstraße 32“ und „34“ bekannt.
1939 führte man diesen Teilabschnitt geradeaus weiter bis zur Urweilerstraße – durch einen Garten zwischen zwei Häusern hindurch. Diesen Abschnitt nannte man „Marienstraße“. Aus „Hospitalstraße 32“ und „34“ wurden nun Marienstraße 3 und 1.
Jakob wohnte also tatsächlich in der späteren Marienstraße 3 – im Haus der Familie Lehmann – bis seine Eltern am 19. Juni 1935 auswanderten.
Jakob auf der Flucht
Am gleichen Tag, an dem seine Eltern St. Wendel verlassen, zieht Jakob nach Rohrbach:
„Als ich als Verwalter am Rohrbacher Hof beschäftigt war, hatte ich ebenfalls freie Kost und Logie und Bekleidung (inklusive Zigaretten und Getränke) und außerdem 60 Reichsmark pro Monat.“
Zuvor hatte er noch seinen Führerschein der Klasse 3 gemacht – ausgestellt am 20. Mai 1935 vom „Landrat als Verkehrspolizeibehörde“.
[LEA 8724]
Auf dem Rohrbacher Hof – heute Glashütter Hof – arbeitete Jakob beim Eigentümer Erwin Rühling als Volontär. Leider war er dort nur ein paar Monate (12.6.–28.8.1935).
„Auf Betreiben der NSDAP musste ich dieses Gut und meinen Posten dort verlassen.“
Ab dem 17.08.1935 war er wieder in der Hospitalstraße 32 gemeldet. Am 30. September begann er eine ähnliche Stelle auf dem Faulenberger Hof zwischen Mainz- und Urexweiler. Dort durfte er immerhin drei Monate bleiben – wurde aber wohl auch dort vertrieben.
Am 17. Januar 1936 zog er zu seinem Bruder David in die Balduinstraße 37. Doch schon am 22. Februar 1936 reiste er nach Palästina aus – weshalb er nicht anwesend war, als David im März heiratete.
Rückkehr zur Hochzeit – und Abschied
Keine fünf Monate später war Jakob wieder da. Wann und wo er seine zukünftige Ehefrau kennengelernt hat, wird auf ewig sein Geheimnis bleiben – jedenfalls kam er am 17. Juli von Palästina zurück nach St. Wendel und meldete sich in der Bungertstraße 5 an.
Dort wohnte die Familie Sender.
Die Familie Sender
Gustav Sender, Viehhändler und Handelsmann, geboren am 2. August 1880 in Bosen, heiratete im Februar 1905 Johannetta, gen. Jenny Mayer, geboren 1875 in Lachen. Ihre Tochter Selma kam am 25.01.1906 in Lachen zur Welt.
Am 1. Februar 1906 kam die Familie nach St. Wendel. Sie wohnte im Kirchgäßchen 2, das Gustav kurz vor seiner Heirat von seinen Eltern Abraham Sender und Johannetta Lion für 7.500 Mark gekauft hatte.
[Quelle: www.wormserjuden.de]
Kirchgäßchen 2: So sieht das Haus heute auf der Ecke zur Josefstraße aus.
Die Ehe wurde vor 1913 geschieden. Ex-Frau und Tochter kehrten in die Pfalz zurück. Johannetta starb am 8. August 1939. Ihre Tochter Selma Sender wohnte später in Mannheim, Berlin und Worms. Sie versuchte, nach Kanada oder in die USA auszuwandern, wurde aber im Oktober 1940 bei der Sonderaktion gegen pfälzische und badische Juden nach Gurs/Südfrankreich deportiert und später über Drancy nach Auschwitz gebracht und dort ermordet.
Gustav Sender heiratete 1913 erneut: Emma Meyer, geboren 1873 in Wellesweiler. Sie wohnten im Kirchgäßchen 2 bis 1927.
Dann zogen sie in den Neubau von Rudolf Schunath in „Breiten 46b“ – heute Bungertstraße 5. Warum sie umzogen, ist nicht bekannt. Möglicherweise konnten sie einen Kredit bei der Central-Genossenschaftsbank Saarbrücken nicht bedienen, und das Haus wurde eingezogen.
Flucht und Entzug der Staatsbürgerschaft
Ende 1937 traten die Senders ihre Flucht an. Deutschland entzog ihnen daraufhin die deutsche Staatsangehörigkeit.
Was löst das bei einem Menschen aus? Er weiß, dass er Deutscher ist, aber sein Vaterland ihn nicht als solchen ansieht – nicht einmal als Mensch.
Mein erster Gedanke war: Exkrement drauf.
Aber wenn ich länger drüber nachdenke, dann hat dieser Entzug auf die vorhandene Niedergeschlagenheit noch einen draufgesetzt. Bah, das ist richtig fies.
Gustav, Emma und ihr Sohn Albert flohen nach Paris. Emma starb am 25. August 1940 dort. Gustav wurde im Juni 1943 bei einer Razzia festgenommen und am 23.06.1943 in Auschwitz ermordet.
Am 19. September 2012 wurde ihm ein Stolperstein vor dem Haus Bungertstraße 5 gesetzt – organisiert vom Verein „Wider das Vergessen und gegen Rassismus“ in Marpingen. Der Stein wurde jedoch einige Jahre später gestohlen und nie ersetzt. Die Stadt füllte die Lücke pragmatisch mit einem Pflasterstein.
Albert Sender, Gustavs Sohn, überlebte. Am 13. September 1950 wurde er in Lyon gemeldet und erhielt 1967 die französische Staatsangehörigkeit. Er starb 1998 in Pierre-Bénite, Rhône.
Hochzeit: Irene und Jakob
Irene Johanna Sender, geboren am 24. Juni 1914 in St. Wendel, heiratete Jakob Gerber am 24. September 1936.
Die Familienüberlieferung sagt, er sei extra aus Palästina zurückgekommen, um sie zu heiraten – und habe sogar Tickets für ihre Eltern mitgebracht. Die lehnten angeblich ab – wohl wegen des Sohnes Albert, für den es kein Ticket gab.
Trauzeugen:
– Eduard Reinheimer, Handelsmann, 44 Jahre
– Hermann Singer, Kaufmann, 43 Jahre (auch Trauzeuge von Bruder David)
Die Familie Reinheimer
Eduard Reinheimer war mit seinen Eltern Abraham Reinheimer und Fanny Beildeck um die Jahrhundertwende aus dem pfälzischen Walhalben nach St. Wendel gekommen. Er wurde 1892 geboren. Sie wohnten in der Neumarktstraße und später in der Hospitalstraße 13.
Von den elf Kindern der Familie überlebte keines in Deutschland. Der älteste, Isaac, fiel 1915 in Frankreich. Sein Schwager Max Levy war bereits ein halbes Jahr zuvor gefallen.
Die übrigen zehn Kinder wurden Opfer des Holocaust. Viele flohen nach Holland, wurden dort später gefasst und deportiert.
Eduard selbst war mit seiner Familie ebenfalls geflohen, kehrte aber ein Jahr später zurück nach St. Wendel. Er betrieb mit Louis Mendel das Kleidergeschäft „Reinheimer und Mendel OHG“ in der Schlossstraße 2. Mendel wurde 1935 ausgewiesen, überlebte das Dritte Reich in Frankreich. Reinheimer verkaufte das Geschäft am 23.12.1935 an Gustav Weyrich.
Warum Eduard Reinheimer und seine Familie nicht flohen, ist unklar. Sie wohnten bis 1941 in der Balduinstraße 41 und wurden dann – so steht es zynisch in ihrer Meldekarte – „von der Staatspolizei ausgewiesen“.
Eduard, seine Ehefrau Alice Hermine Bonem (*1898 in Saarwellingen) und ihre Tochter Sara Ilse (*1921 in St. Wendel) wurden kurz nach dem 11. September 1942 in Auschwitz ermordet.
Flucht nach Palästina und Leben im Exil
Jakob Gerber und seine Frau Irene Johanna Sender verließen nach der Hochzeit St. Wendel – nicht nach Frankreich, sondern nach Palästina.
„Ich kam noch einmal im Juli 1936 zurück nach Deutschland, um meine Braut, Johanna Irene Sender, am 12. September 1936 zu heiraten, und ich flüchtete am 1. Oktober 1936 mit meiner Frau infolge eines Haftbefehls, der durch die Gestapo gegen mich erlassen wurde, zurück nach Palästina.“
Entschädigungsanträge nach dem Krieg
Als Jakob 1957 über die United Restitution Organisation (URO) Entschädigungsansprüche gegen die Bundesrepublik stellte, wollte er zunächst nur 600 Reichsmark ersetzt bekommen – die ihn seine Auswanderung gekostet hatte.
Umgerechnet nach § 11 Bundesentschädigungsgesetz (BEG) erhielt er 120 DM plus 6 Mark Zinsen.
Die URO ist eine internationale Organisation, die Betroffenen Rechtshilfe bei der Rückerstattung von Eigentum und Entschädigungen für NS-Verfolgung bietet.
Sie wurde 1948 in London gegründet, auf Initiative des Council of Jews from Germany.
Mit dem Deutschlandvertrag von 1952 verpflichtete sich die BRD zur gesetzlichen Entschädigung von NS-Opfern – das BEG trat in erster Fassung am 18. September 1953 in Kraft (letzte Fassung: 1. August 2021).
Zuständig für die Bearbeitung war die Entschädigungsbehörde des Landes, in dem der Verfolgte zuletzt gewohnt hatte. Für Jakob: das Saarland.
Weitere Ansprüche: Beruflicher Schaden
1963 stellte Jakob weitere Ansprüche. Regierungsassessor Lehne vom Landesentschädigungsamt Saarland antwortete der URO am 10.10.1963:
„Sehr geehrte Herren!
Unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 27.7.1963 schlage ich Ihnen als vergleichsweise Regelung für den Schaden im beruflichen Fortkommen Ihres Mandanten eine Kapitalentschädigung in Höhe von 6150 DM vor.
Als Entschädigungszeitraum habe ich den Zeitraum vom 29.8.1935 bis 31.3.1948 zugrunde gelegt. Die Einstufung erfolgte in den einfachen Dienst mit Versorgungszuschlag.
Maßgebend für diese Einstufung waren die Angaben des Verfolgten über sein Vorverfolgungseinkommen sowie die amtliche Feststellung der Landesversicherungsanstalt für das Saarland, dass Herr Gerber vom 12.6.1935 bis 28.8.1935 bei Herrn Erwin Rühling (Gut Rohrbacher Hof) als Volontär beschäftigt war.“
Jakob erhielt schließlich 126 DM für die Auswanderung und 10.180 DM für den Berufsschaden (Zahlung 1964/1965).
Leben in Palästina / Israel
Am 10. Januar 1965 erschien Jakob Gerber vor dem früheren Rechtsanwalt Dr. Raffael Cahanowitz, Landgerichtsrat a.D., in Tel Aviv – Sachbearbeiter der URO – und schilderte:
„Ich habe bis 1953 als Zimmermann gearbeitet. Das umfasste: Legen von Dachstühlen, Ziegeldecken, Gerüste für Expendit.
In dieser Zeit waren ca. 80 % der Gebäude mit Ziegeldächern versehen. Ab 1954 änderte sich das grundlegend – neue Zementfabriken entstanden, der Preis für Bewehrungsstahl fiel.
Fortan wurden Häuser mit Betondächern gebaut. Dadurch brach die Nachfrage nach Zimmerleuten ein – nur noch saisonale Reparaturarbeiten.
1959 begann ich mich umzuschulen. Heute arbeite ich als Verwaltungsbeamter an der Universität Tel Aviv.“
„Ich bin bis zum heutigen Tag immer völlig gesund gewesen und zu jeder Arbeit fähig.“
Familie Gerber in Israel
Jakob und Irene bekamen zwei Kinder:
-
Schmuel, geboren 1938 in Afula (etwa 40 km südöstlich von Haifa)
-
Haviva, geboren 1939
Sie lebten ihren Lebensabend in der Stadt Petach Tikwa, ein paar Kilometer östlich von Tel Aviv.
-
Irene Johanna Gerber, geb. Sender, starb am 04.03.1987
-
Jakob Gerber starb am 17.01.1988, nur ein dreiviertel Jahr später
Zurück in St. Wendel – mit Ronit und Ofer
Ronit ist Havivas Tochter. Ihre Mutter lebt noch in Israel – heute 86 Jahre alt – und wird mindestens einmal im Jahr von ihr besucht.
Ronits Kinder aus erster Ehe leben ebenfalls mit ihren Familien in Israel. Sie ist bereits Großmutter.
Vor 17 Jahren traf sie Ofer Ben-Amots – für beide ist es die zweite Ehe.
Ofer Ben-Amots
Dr. Ofer Ben-Amots, geboren 1955, ist ein israelisch-amerikanischer Komponist und Dozent für Musikkomposition und -theorie am Colorado College (Colorado Springs, USA).
Seine Werke sind inspiriert von:
-
jüdischer Folklore
-
osteuropäischen jiddischen Traditionen
-
jüdisch-spanischen Ladino-Gesängen
Die Verflechtung von Volksmotiven mit modernen musikalischen Texturen ist sein Markenzeichen. Das beschreibt auch der englischsprachige Wikipedia-Eintrag.
Ronit und Ofer machten auf dem Weg zum ISAM-Festival in Ochsenhausen einen Zwischenstopp in St. Wendel.
ISAM steht für Internationale Sommerakademie für Musik, die in der Landesakademie Ochsenhausen stattfindet.
Ofer ist Mitbegründer und Leiter dieses Meisterkurses für Pianisten, Komponisten und Organisten. Dazu gehören:
-
der Internationale Siegfried-Weishaupt-Klavierwettbewerb
-
der Joseph-Gabler-Orgelwettbewerb
-
der Kompositionswettbewerb „In Memoriam Joseph Dorfman“
-
zahlreiche Konzertabende
Ein Wochenende voller Geschichte
Ofer spricht ein recht gut verständliches Deutsch, Ronit selbst spricht es nicht fließend, versteht aber vieles. Unsere Kommunikation findet in beiden Sprachen statt – was mir hilft, wenn mir mal partout das richtige Wort nicht einfällt oder ein Sachverhalt sich auf Englisch zu schwierig darstellt. Dann wechsle ich in ein nicht zu schnelles Deutsch – und werde trotzdem verstanden.
Zuerst fahre ich mit den beiden hinauf auf den Urweiler Friedhof. Auch wenn dort keine direkten Verwandten von Ronit begraben sind, sind beide von der Stätte beeindruckt. Ich bin beeindruckt, dass sie Hebräisch nicht nur sprechen, sondern auch lesen können. Klar ist das ihre Muttersprache – aber ich verstehe kein Wort und wusste nicht einmal, dass Hebräisch von rechts nach links gelesen wird.
Danach fahren wir in die Alsfassener Straße. Ich fotografiere die beiden vor dem Haus Nr. 80 – auch wenn es heute völlig anders aussieht als früher. Anschließend gehen wir zu uns nach Hause und besprechen meinen digitalen Bestand an Informationen über die Familie Gerber.
Beide sind beeindruckt von den Notariatsakten, wie es sie in den USA nicht gibt – und von der Menge an Namen in meiner Datenbank.
Ein gestohlener Stein
Da ich abends noch eine weitere Stadtführung habe, bringe ich sie gegen sechs zurück ins Hotel – mit einem kleinen Umweg über die Bungertstraße, wo wir nach dem Stolperstein vor Nummer 5 suchen.
Vergeblich.
Der Stein wurde – wie bereits erwähnt – vor über sechs Jahren gestohlen. Ronit ist empört und enttäuscht, als sie sieht, wie mit der Erinnerung an ihre ermordeten Vorfahren umgegangen wird.
Abendessen und Begegnung
Am Sonntagabend haben die beiden meine Frau und mich zum Abendessen eingeladen. Der Wirt des Gudesbergs, Jens Wittwer, kümmert sich intensiv um seine weitgereisten Gäste.
Jens, dafür nochmal meinen besonderen Dank.
Ein Foto: Mein Bauch, Ofer, Jens und Ronit auf der Terrasse des Gudesberg-Restaurants.
Gottesdienstbesuch im Dom
Auf meinen Rat hin besuchen Ronit und Ofer den Gottesdienst im Dom – obwohl katholisch, sie aber Juden sind.
Per WhatsApp schreibt Ofer danach:
„Vieles Christliche hat seinen Ursprung im Jüdischen.“
Beide sind vom Klang der Orgel und der Akustik der Kirche begeistert.
Ich habe versucht, sie mit dem Organisten der Basilika ins Gespräch zu bringen – aber er hat vermutlich meine E-Mail nie erhalten. Leider hat auch die Lokalredaktion der Saarbrücker Zeitung nicht auf meine Interview-Anfrage reagiert. Schade.
Letzter Tag in St. Wendel
Am Montagmorgen hole ich die beiden um 10 Uhr am Hotel ab. Sie wollen sich unbedingt den Globus ansehen – denn so große Kaufhäuser gibt es in Colorado nicht.
Allerdings ist schönes Wetter für den Vormittag gemeldet und Regen am Nachmittag. Deshalb nehmen wir uns zuerst die Außentermine vor – und verschieben das Einkaufen auf später.
Sötern: Synagoge, Friedhof, Erinnerung
Wir fahren quer durchs St. Wendeler Land nach Sötern, auf den jüdischen Friedhof. Sötern ist ein langes Straßendorf.
Wir passieren die Untere Mühle, hoppeln über den ehemaligen Bahnübergang – der alte Schienenweg ist längst ein Rad- und Wanderweg, wie man das heute so macht.
In der Ortsmitte ist Kirmes – Zelte stehen auf dem Dorfplatz.
Wir fahren an der Kirche vorbei. Irgendwo geht’s links rein, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Da ist das kleine Häuschen, das bei einer Führung des Adolf-Bender-Zentrums vor Jahren als Mikwe – ein jüdisches Ritualbad – präsentiert wurde. Schon damals stand es kurz vor dem Auseinanderbrechen.
Wir fahren weiter und schauen uns die Synagoge an. Die steht noch. Ich parke etwas weiter weg.
Vor dem ehemaligen Gebäude mit Tankstelle liegt ein großer Haufen Schutt – davor steht auch eine Tafel.
Irgendwie passt der Schutt zum Großen und Ganzen – geplant oder zufällig?
Ein Spaziergänger erzählt uns, was er von seinen Eltern über die jüdische Geschichte gehört hat. Er zeigt uns auch die vier Stolpersteine für Familie Koschelnik in der Hauptstraße.
Der jüdische Friedhof von Sötern
Wir finden den Weg zum Friedhof dank der Beschreibung: Am Kirmesplatz rechts rein, halbe Straßensperre, dann geradeaus – unter der Autobahn hindurch. Rechts das riesige Solarfeld, links der gesuchte Friedhof.
Er hat sich in den Jahren nicht wirklich verändert – nur das Gras ist gewachsen, sehr.
Der Friedhof ist lang und rechteckig. Die vordere Hälfte ist leer. Ein breiter Pfad führt durch die Mitte.
Links vorne liegen einige Grabsteine, die umgefallen oder umgeworfen wurden – und auf der Nase liegen.
Ob man sie wieder aufstellen sollte, ist eine Sache – aber sie so liegen zu lassen, dass niemand ihre Namen lesen kann … pfff. Ich weiß nicht.
Wir suchen nach Vorfahren der Familie Sender – Irenes Vaterlinie. Aber uns fehlen zwei Dinge:
-
eine vollständige Ahnentafel
-
ein Mittel, um verwischte Inschriften sichtbar zu machen
Wir versuchen es mit Wasser aus einer Sprudelflasche – aber das funktioniert nicht. Dann erinnere ich mich an etwas aus dem Val Camonica: Dort rieb ein Einheimischer Gras auf eine Felszeichnung, und das Bild wurde sichtbar.
Gras gibt es hier genug – aber es ist zu trocken. Moos an der Mauer funktioniert viel besser. Es lässt sich zerreiben, ohne viel Erde.
Plötzlich beginnen Ronit und Ofer mit der Übersetzung der hebräischen Inschriften, ich mit der lateinischen Schrift.
Wir finden viele Sender und Baum – können sie aber nicht sicher zuordnen.
Mittag, Musik und Erinnerungen
Emmas Eltern – Irenes Großeltern mütterlicherseits – wären hier ohnehin nicht zu finden: Sie stammten aus Wellesweiler, nicht aus Sötern.
Gustav Senders Eltern waren nach St. Wendel gezogen und dort gestorben. Sein Großvater Israel Sender, gestorben 1893 in Sötern, hätte hier liegen können – aber ich habe die Familie noch nicht so weit zurückverfolgt.
Es ist Mittag. Ich hole mir eine Rostwurst, die schmeckt ganz gut. Im Zelt gibt es Gefüllte, aber da ist zu viel Andrang. Ronit und Ofer begnügen sich mit einer Crêpe.
Ronit schaut sich um – und fragt verwundert:
„Wie kann man um diese Uhrzeit schon Bier trinken?“
Ich verkneife mir die Antwort.
Ein örtlicher Musikverein spielt, Ofer ist beeindruckt vom Arrangement und der Darbietung. Ich erzähle ein paar Schwänke aus meiner Zeit im Baltersweiler Musikverein, wo ich mal die Posaune malträtiert habe. Lang, lang ist’s her.
Bosen, Erinnerungen – und ein bisschen Jetlag
Unser nächstes Ziel ist Bosen. Wieder passieren wir den Söterner Friedhof – denn ich weiß: da kommt man irgendwie hin.
Wir fahren kreuz und quer, spiegeln mal links, mal rechts – und landen schließlich in Eckelhausen. Eingangs Bosen halten wir am Kriegerdenkmal, dem gerade ein paar Gemeindearbeiter mit Rechen und Laubbläsern zu Leibe rücken.
Ihr Wagen blockiert die Zugangstreppe. Wir steigen – besser: klettern – über eine Mauer. Danach zeigt sich: Die Arbeiter haben das Auto zuvorkommend ein paar Meter vorgefahren. Rückweg viel einfacher.
Ein Hinweisschild zeigt zur Mikwe in Bosen – aber die ist natürlich verschlossen.
Am Bostalsee trinken wir einen Kaffee, essen Kuchen, reden über Gott und die Welt.
Auf dem Weg zum Schaumberg wird klar: Der Globus wird heute ohne die beiden Umsatz machen müssen – denn Ofer auf dem Beifahrersitz fallen zunehmend die Augen zu.
„Das ist der Jetlag“, sagt er und lacht.
Sie sind am Freitag gelandet und direkt nach St. Wendel gekommen, übernachten im Hotel „Angels“. Der längere Spaziergang gestern fiel schon dem ausgearteten Mittagsschläfchen zum Opfer.
Jetlag ist eklig.
Hin nach Amerika geht’s – man wird ein paar Tage zu früh wach.
Aber zurück: Man sieht im Flugzeug die Sonne untergehen, zwei Stunden später wieder aufgehen – und hat sechs Stunden verloren.
Und das wird mit zunehmendem Alter nicht besser.
Schaumberg und Kloster Tholey
Trotzdem: Der Schaumberg muss sein.
Ich verhalte mich wie der Standardtourist (ach – darf man da nicht mit dem Auto durch?) und fahre bis ganz hinauf.
Die Sonne scheint, aber aus Westen dräuen üble Wolken. Den obligatorischen Euro pro Person zahlen wir gerne.
Als Ronit den Turm hinaufschaut, kommt sie schnell von ihrer Idee ab, zu Fuß hochzugehen.
Die Aussicht von oben ist klasse. Wir blicken in alle vier Himmelsrichtungen – ich behalte den Westen im Auge.
Wir schaffen es zurück ins Auto – trocken.
Erst als wir vor der Abtei Tholey halten, beginnt es zu regnen.
In der großen Kirche interessieren sich die beiden weniger für die Fenster – obwohl Ofer den Namen „Gerhard Richter“ kennt.
Aber die Orgel hat es ihm angetan. Ich trage mich in die Kondolenzliste für Abt Mauritius ein.
Ich erinnere mich an ein Erlebnis mit ihm: Ich durfte vor Jahren die Klosterbibliothek wieder einräumen – mit neuen Regalen, systematischer Sortierung, Umzugskartons überall. Doch die Kartons waren durcheinandergekommen, die Suche also ein Abenteuer.
Einmal war ich allein im tiefen Keller, alte Römerwände vermutlich um mich herum – und ich Depp hatte am Vorabend einen Horrorfilm gesehen. Ich sang laut – half aber nichts.
Als ich in einen Raum spähte, lagen dort fünf einfache Holzsärge aufgestapelt. Ich erschrak furchtbar.
Später fragte ich Abt Mauritius:
„Was hat es mit den Särgen auf sich?“
Er lachte:
„Nun, wir sind zwölf Mönche im Kloster. Man weiß nie, wann einer geht. Also achte ich darauf, dass wir immer einen Vorrat an Särgen haben.“
Er bestellte sie übrigens günstig bei eBay. Und lachte noch lauter, als ich ungläubig guckte.
Ein feiner Mann. Es hat mir sehr leid getan, als ich von seinem Tod hörte.
Ein Kompliment, das bleibt
Ich erzähle die Geschichte auf der Rückfahrt. Am Hotel angekommen, macht mir Ofer ein Kompliment, das mich wirklich berührt:
„Normalerweise bin ich der Lehrer – aber an diesem Wochenende war ich der Student.“
Abschied
Am nächsten Morgen fahre ich nochmal mit dem Rad zum Hotel, um den beiden eine gute Reise zu wünschen.
Ihr Zug geht um 12:20 Uhr, das Taxi ist für 11:30 Uhr bestellt.
Ich bin erstaunt:
„Ein Taxi? Für die paar Meter?“
„Nicht wegen der Entfernung“, sagen sie, „sondern wegen der Koffer: nur kleine Räder, und das Kopfsteinpflaster zur Bahnhofstraße – das überleben die nie.“
„Ein Taxi ist billiger als ein neuer Koffer.“
– Ist ein Argument.
Ein Notenbuch, das seinen Ort gefunden hat
Am Abend zuvor hatte ich noch an Ronits Stammbaum gearbeitet, mit Hilfe des Buches „Unsere vergessenen Nachbarn“ von Eva Tigmann und Michael Landau – viele Bosener Juden, viele Sender.
Ich habe aber noch ein anderes Geschenk:
Ein altes Notenbuch, handgeschrieben, gekauft auf dem Flohmarkt vor 20 Jahren. Es stammt von Jakob Wommer aus Wolfersweiler, datiert 1856.
Ich habe es oft gezeigt – niemand interessierte sich dafür.
Nur Ofer.
Er erkannte die Systematik, sang daraus die Hymne „Großer Gott, wir loben Dich“ – und ich erkannte die Melodie.
Ich wusste: Dieses Buch hat endlich seinen Platz gefunden.
In guten Händen.
Ein Schirm, der mitfliegt
Der St. Wendel-Regenschirm hat den beiden gefallen. Die Touristinfo wusste Rat – beim Stroppel in der Oberstadt kauften sie ein Exemplar.
„Er passt zwar nicht in den Koffer“, sagt Ronit,
„aber das Ding kriege ich schon nach Hause.“
Und vielleicht nächstes Jahr …
Jetzt sind sie in Ochsenhausen, Ofer unterrichtet dort.
Ronit hat ihren Onkel und ihre Mutter von unserem Treffen erzählt.
Und ihre Mutter – jetzt 86 – will unbedingt die Stadt kennenlernen,
wo ihre Eltern sich kennengelernt haben.
Vielleicht nächstes Jahr.