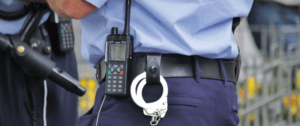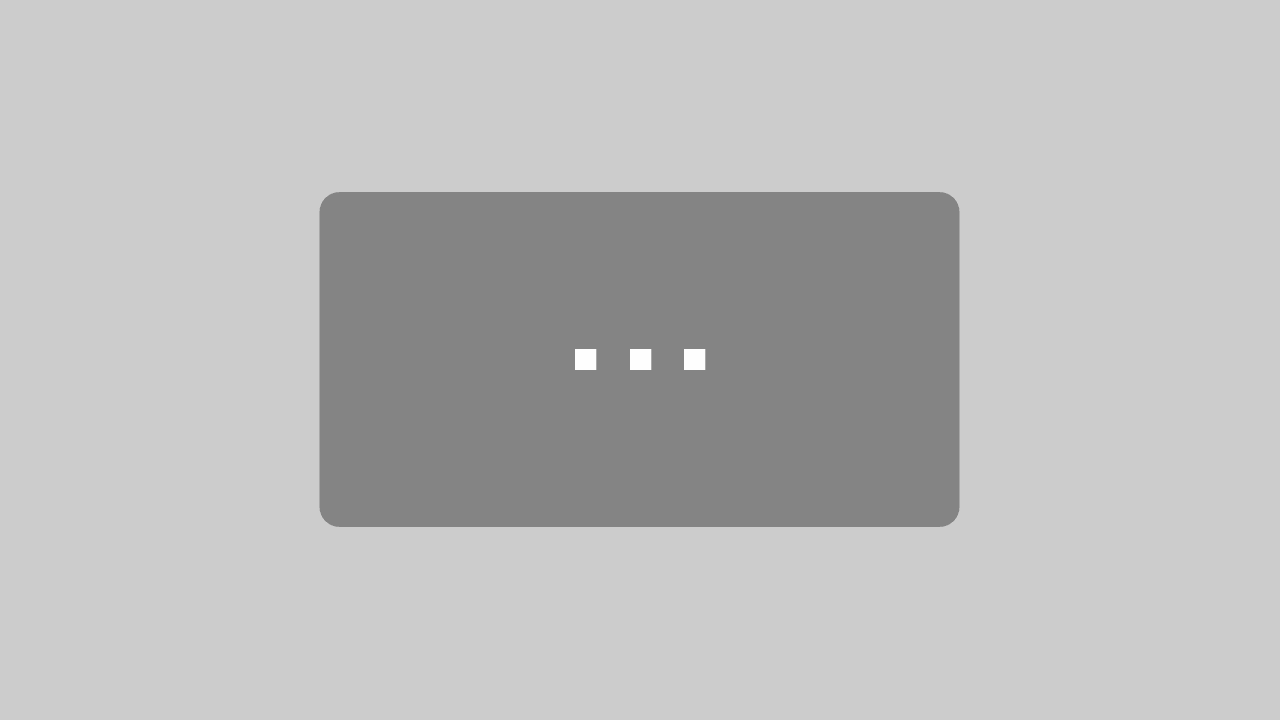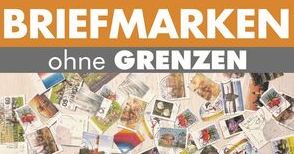Die Zukunft des Heizungsgesetzes sorgt weiter für Spannungen in der Bundespolitik. Während Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) bekräftigt, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bleibe „im Grundsatz“ erhalten, verlangt CSU-Chef Markus Söder im ZDF eine vollständige Rücknahme. Die „massive Überförderung“ müsse gestoppt werden, so Söder. Die Ampelkoalition hingegen setzt auf Kurskorrekturen – nicht auf einen Bruch mit dem Gesetz.
Im Koalitionsvertrag wurde zwar die „Abschaffung“ des bisherigen GEG angekündigt, doch gemeint ist offenbar eine Reform. Union und SPD wollen laut Vereinbarung die Förderprogramme für Sanierungen und klimafreundliche Heizsysteme fortsetzen – nur effizienter und zielgerichteter.
Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG), auch als „Heizungsgesetz“ bekannt, stellt die Weichen für den schrittweisen Abschied von fossilen Heizsystemen. Der Betrieb reiner Öl- und Gasheizungen wird bis spätestens 2045 verboten. Schon jetzt gelten klare Fristen und Pflichten – aber auch umfangreiche Fördermöglichkeiten.
Warum muss die Heizung raus?
Ein zentrales Ziel des Gesetzes ist es, den CO₂-Ausstoß im Gebäudesektor deutlich zu senken. Der Wärmemarkt verursacht rund ein Drittel der energiebedingten Emissionen in Deutschland. Um Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, müssen fossile Heizsysteme – vor allem Gas- und Ölheizungen – ersetzt oder mit erneuerbaren Energien kombiniert werden.
Die 30-Jahre-Regel: Ältere Heizungen vor dem Aus
Ein besonders klarer Stichtag ergibt sich aus der sogenannten 30-Jahre-Regel (§ 72 GEG): Heizkessel, die vor mehr als drei Jahrzehnten installiert wurden und nach dem Konstanttemperaturprinzip arbeiten, müssen verpflichtend ausgetauscht werden. Auch wenn sie noch funktionstüchtig sind.
Beispiel: Wurde der Kessel 1995 eingebaut, endet seine Laufzeit 2025. Der Gesetzgeber will so ineffiziente Technik aus dem Verkehr ziehen. Ausgenommen sind moderne Brennwert- und Niedertemperaturkessel, sehr kleine (< 4 kW) oder sehr große Anlagen (> 400 kW) sowie hybride Heizsysteme, bei denen erneuerbare Energie bereits den Hauptanteil liefert.
Wer diese Frist ignoriert, riskiert ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro – abhängig vom Ausmaß des Verstoßes. Die Überwachung erfolgt durch den Schornsteinfeger, der die Anlagen regelmäßig prüft.
65-Prozent-Erneuerbare-Regel ab 2024 – mit Fristen
Seit Januar 2024 dürfen in Neubauten nur noch Heizungen eingebaut werden, die zu mindestens 65 Prozent auf erneuerbaren Energien basieren. Dazu zählen:
-
Wärmepumpen
-
Pellet- oder Holzheizungen
-
Fernwärme oder Nahwärme mit hohem EE-Anteil
-
Solarthermie
-
oder H2-ready-Gasheizungen mit Zukunftsperspektive
Für Bestandsgebäude gilt: Die Pflicht zum 65-Prozent-Anteil greift erst, wenn eine neue Heizung eingebaut wird – nicht bei Reparaturen. Die konkrete Frist hängt von der kommunalen Wärmeplanung ab. Großstädte mit über 100.000 Einwohnern müssen bis 30. Juni 2026 ihre Wärmeplanung vorlegen, kleinere Kommunen haben dafür bis 30. Juni 2028 Zeit. Erst wenn diese Planung vorliegt, greifen die Vorgaben verbindlich.
Neue Gasheizungen? Nur mit Einschränkungen
Theoretisch ist auch nach Inkrafttreten des GEG noch der Einbau neuer Gasheizungen möglich – allerdings unter Auflagen. Ab 2029 müssen diese stufenweise mit erneuerbaren Gasen betrieben werden:
-
ab 2029: mindestens 15 % EE-Gas (Biomethan oder Wasserstoff)
-
ab 2035: mindestens 30 %
-
ab 2040: mindestens 60 %
Spätestens ab 2045 endet der Betrieb fossiler Heizsysteme komplett. Wer heute eine Gasheizung einbauen lässt, muss sich verpflichtend über Risiken und Alternativen beraten lassen – schriftlich und vor dem Einbau.
Ausnahmefälle und Sonderregelungen
Das GEG sieht zahlreiche Ausnahmen vor, um Härtefälle abzufedern:
-
Heizungsdefekt (Havarie): Vorübergehender Ersatz mit gebrauchter fossiler Heizung möglich – Laufzeit maximal 5 Jahre.
-
Geplantes Wärmenetz: Wenn ein Anschluss geplant ist, darf die Gasheizung bis zur Fertigstellung genutzt werden – max. 10 Jahre.
-
Hybridheizungen: Kombination mit Wärmepumpe oder Solarthermie möglich, wenn der EE-Anteil überwiegt.
-
Bestandsschutz: Eigentümer, die vor dem 1. Februar 2002 selbst ins Haus eingezogen sind, müssen ihren alten Kessel nicht tauschen.
-
Denkmalschutz oder Unzumutbarkeit (z. B. bei hohen Kosten oder gesundheitlichen Einschränkungen) können zur Befreiung führen.
Fördermöglichkeiten – wer schnell ist, profitiert
Das Bundeswirtschaftsministerium fördert den Heizungstausch im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) mit bis zu 70 Prozent Zuschuss. Die wichtigsten Bausteine:
-
30 % Grundförderung: Für alle Eigentümer – einkommensunabhängig.
-
30 % Sozialbonus: Für Haushalte mit maximal 40.000 € zu versteuerndem Einkommen pro Jahr.
-
20 % Klima-Geschwindigkeitsbonus: Für alle, die ihre Heizung freiwillig bis Ende 2028 tauschen oder zusätzliche energetische Maßnahmen umsetzen (z. B. neue Fenster, Dämmung).
Wichtig: Die Förderhöhe ist gedeckelt – der maximale förderfähige Betrag beträgt 30.000 Euro pro Wohneinheit.
Welche Alternativen gibt es?
Wärmepumpe: Besonders effizient, benötigt jedoch gut gedämmte Gebäude. Arbeitet mit Umweltwärme aus Luft, Wasser oder Erde.
Pelletheizung: CO₂-neutral, benötigt jedoch Lagerraum für das Brennmaterial.
Solarthermie: Unterstützt Warmwasserbereitung und Heizung, besonders effektiv in Kombination mit anderen Systemen.
Fernwärme: Abhängig vom Ausbau in der Region, zukunftssicher bei hohem EE-Anteil.
H2-ready-Gasheizungen: Nur sinnvoll, wenn regional eine Wasserstoffinfrastruktur geplant ist – aktuell teuer und unsicher.