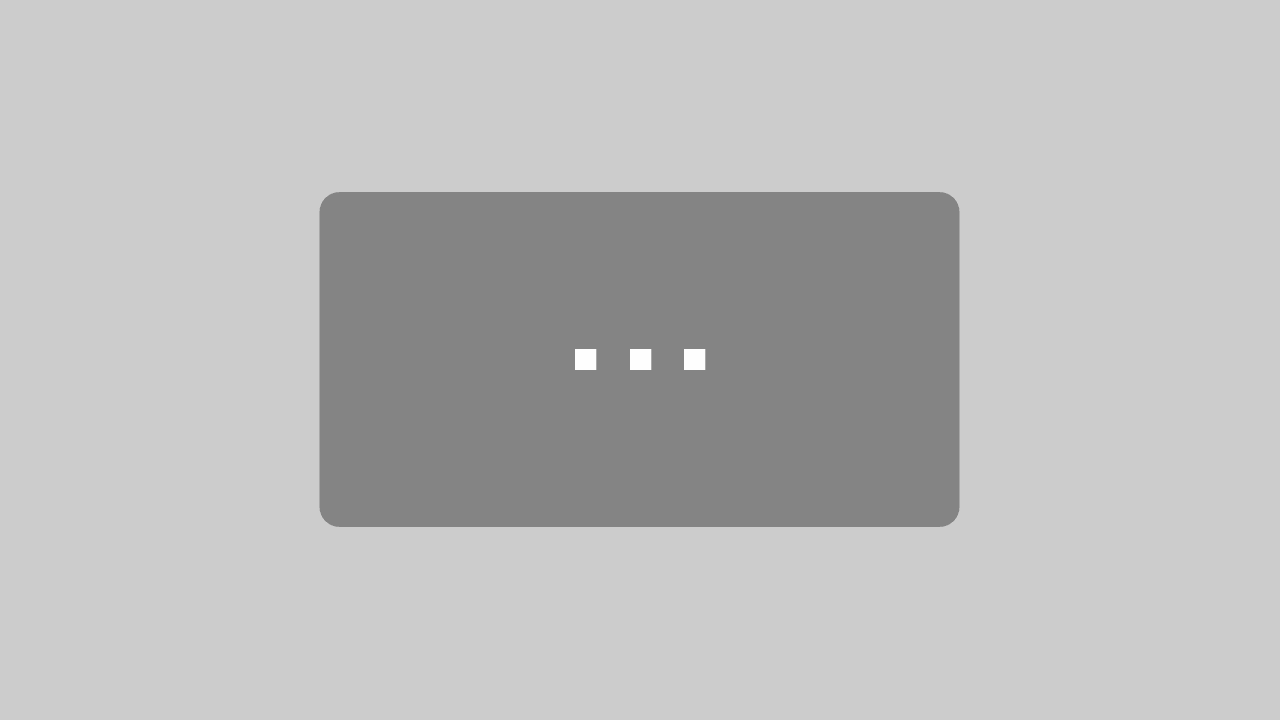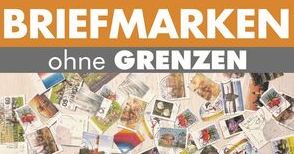Die Bundespolitik diskutiert aktuell über die Begünstigungen und Befreiungen im Bereich der Lohn- und Einkommenssteuer, um die Überstunde für Mitarbeitende attraktiver zu machen. Der daraus resultierende Anreiz zur Mehrarbeit diene als Lösungsansatz für den Fachkräfte- bzw. Arbeitskräftemangel, einer gerechteren Bezahlung und schlussendlich dem Wirtschaftswachstum. Als gewisser Kontrast hierzu stehen die Diskussionen rund um die Vier-Tage-Woche, die 35-Stunden-Woche oder beispielsweise den Sechs-Stunden-Tag. Im Kern geht es in der Diskussion um das Thema der Produktivität und ihrer klugen und zielgerichteten Optimierung. Produktivität beschreibt das Verhältnis zwischen erzieltem Output und eingesetztem Input.

Eine Kenngröße der Produktivität ist die sogenannte Arbeitsproduktivität. Sie beschreibt die Arbeitsleistung je Mitarbeitenden, häufig gemessen je Erwerbstätigenstunde. Erfreulich zu beobachten ist, dass die Arbeitsproduktivität ist seit den neunziger Jahren bis heute enorm angestiegen ist. Entgegen mancher Stammtischparole sind die Menschen nicht fauler oder unproduktiver geworden. Für die Zukunft ist es allerdings keine Frage, dass unser Wohlstandsniveau nur mit Produktivitätsgewinnen erhalten oder ausgebaut werden kann. Mit den Herausforderungen des Strukturwandels, geoökonomische Verschiebungen, demografische Entwicklungen und der resultierende Fachkräftemangel stellen deutliche Herausforderungen die zukünftige Produktivitätsentwickung infrage. Gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel zeigt eine Prognose der IHK Saarland die Dringlichkeit innovativer Produktivitätsmodelle: Dem saarländischen Arbeitsmarkt werden bis zum Jahr 2040 ca. 87.000 Arbeitskräfte weniger zur Verfügung stehen. Wäre nun der Schlüssel zu dieser Lösung in der Steigerung des Renteneintrittsalters und der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit?
Zunächst sollte vielmehr eine kluge Weiterentwicklung der gegenwärtigen Produktivität (u.a. Boden-, Energie-, Arbeits- und Kapitalproduktivität) im Fokus stehen.
Hierzu gibt es viele Ansätze, von denen an dieser Stelle zwei aufgegriffen werden sollen: Erstens lässt sich mit ziel- und ergebnisorientiertem Arbeiten viel mehr erreichen als zeitbezogenen Abarbeiten von Aufgaben. Uwe Engelhardt, Experte im Bereich Unternehmensführung, hat in einem Gastkommentar für das HandwerkMagazin drei sehr hilfreiche Fragestellungen bezogen auf die Produktivität formuliert:
- „Welchen Anteil können wir direkt mit Kunden abrechnen, weil wir in diesen Stunden eine Leistung (Wertschöpfung) erbracht haben?
- Welche Zeit betrachten (verbuchen) wir als Investition in die Zukunft, weil sie dazu dient, künftig mehr Umsatz/Gewinn zu erzielen?
- Welche Stunden sind unproduktiv und schmälern den Gewinn?“
Kennen Sie in dem Zusammenhang auch das Parkinsonsche Gesetz? Dieses verfolgt folgenden Gedankengang: Eine Aufgabe nimmt sich die Zeit, die man ihr zur Verfügung stellt. An einer Firmenpräsentation kann ich persönlich zwei Wochen täglich eine Stunde arbeiten, oder das wesentliche in einer Stunde zusammentragen. Mit diesem Selbstverständnis entstehen häufig in geringeren Zeitintervallen dieselben oder teilweise sogar höhere Ergebnisse. Neben dem zielorientierten Arbeiten bietet zweitens ein offener Umgang mit technologischen Neuentwicklungen die Chance auf Produktivitätssteigerungen. Beispielsweise lässt sich mit generativer KI (z. B. ChatGPT) im Büro Zeit bei der Formulierung von E-Mails, Flyern, Einladungen und Kolumnen (SCHERZ!) einiges an Zeit sparen. Bei Investitionsentscheidungen ist also immer auch der Blick auf erzielte Produktivitätsgewinne entscheidend. Die Liste möglicher Ansätze zur Produktivitätssteigerung ist lang und hängt immer auch von der Branche ab. Beispielsweise ist der Aspekt der Betriebsmittelproduktivität in einem Industrieunternehmen bedeutender als in manch wissensorientierter Dienstleistung. Entscheidend bleibt die Umkehr in der gesamten Herangehensweise: Es sollte eher die Frage beantwortet werden, was gearbeitet wird anstelle der Frage wie viele Stunden. Ob sich automatisch überall der Outcome ändert, wenn die Arbeitsstunden erhöht oder reduziert werden – dahinter ist sicherlich ein Fragezeichen zu setzen.