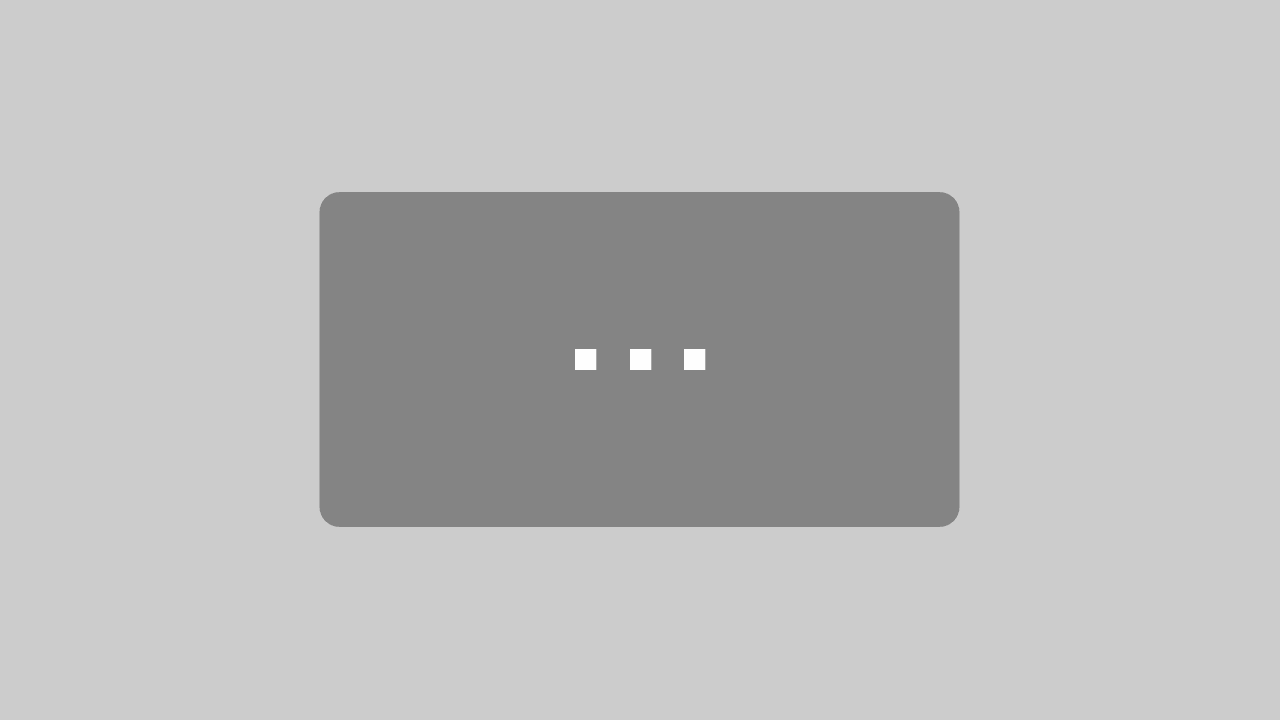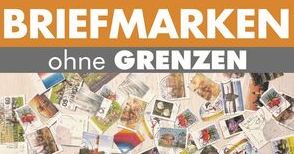Die Ergebnisse der Kurzzeit-Messungen zur Radon-Belastung in Wohnhäusern liegen nun vor. In 41 der 1220 Häuser wurde der gesetzliche Referenzwert von 300 Bq/m³ erreicht oder auch überschritten. Dies entspricht 3,4% aller ausgewerteten Privathäuser.
„Damit liegen wir im Bundesdurchschnitt. Frühere deutschlandweite Messungen haben ergeben, dass durchschnittlich 3% aller Häuser Radonaktivitäten oberhalb von 300 Bq/m³ aufweisen“, informiert Umweltminister Reinhold Jost.
Der Anteil der Häuser mit Werten über 300 Becquerel ist in Merchweiler, Nohfelden, Saarwellingen und Schiffweiler am größten. In Nohfelden wurde in 4 von 29 Gebäuden eine Belastung festgestellt.
„Für eine Beurteilung der Lage oder gar Festlegung von Radonvorsorgegebieten ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh. Erst wenn alle Messergebnisse vorliegen – mit den Resultaten der Messungen in Schulen und Kitas rechnen wir im Oktober – wird eine bessere Einschätzung der Lage in den Gemeinden möglich sein und wir können gegebenenfalls im nächsten Schritt die Datenlage durch weitere Messungen verdichten“, erläutert Jost weiter.
Nach dem Strahlenschutzgesetz sind die Bundesländer verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2020 so genannte Radonvorsorgegebiete auszuweisen. Das sind Gebiete, in denen ein erhöhtes Vorkommen des in höheren Konzentrationen gesundheitsgefährdenden Edelgases nicht ausgeschlossen werden kann. In diesen gelten dann bestimmte gesetzliche Anforderungen zum Schutz vor Radon. Das saarländische Umweltministerium hat im Februar eine Mess-Kampagne gestartet. Sie soll einen Überblick geben über die Radon-Belastung im Boden und in Gebäuden.
Neben Messungen in Gebäuden wurden auch Bodenluftmessungen durchgeführt. Hierzu wurden im Saarland 70 Messpunkte bestimmt. Ausgewählt wurden solche Stellen, die nach ihrer geologischen Struktur eine erhöhte Radonkonzentration im Boden erwarten lassen. 53 dieser Messpunkte wurden inzwischen beprobt.
„Was wir zum jetzigen Zeitpunkt sagen können: Die Ergebnisse der bislang 53 Bodenmessungen entsprechen beziehungsweise liegen noch zum großen Teil unter den Vorhersagen der aktuellen Radonprognosekarte des Bundesamtes für Strahlenschutz, die auf früheren Messwerten basieren“, so Jost.
Der bisher höchste Wert ist im Umfeld von Marth im Ostertal mit 262,5 kBq/m3 gemessen worden. Weitere Messpunkte in der Nähe zeigen normale Werte (Freisen: 56,24 kBq/m3, Oberkirchen: 45,78 kBq/m3). 1 kBq/m3 entspricht dabei 1000 radioaktiven Zerfällen pro Kubikmeter Luft.
„Generell lassen sich aus Radonbodenluftmessungen keine direkten Rückschlüsse auf eine Radonbelastung in Gebäuden ziehen. Sie dienen vielmehr der Veranschaulichung des lokalen Radonpotentials im Boden“, erklärt Jost.
Geologisch betrachtet liegen die Werte im Saarland generell im bundesdeutschen Durchschnitt. Extrem hohe Messwerte wie sie in Teilen des Schwarzwaldes oder im Erzgebirge (>300.000 Bq/m³) zu finden sind, sind im Saarland nicht vorhanden.
In den allermeisten Fällen liegt der Mittelwert der Messergebnisse in der Bodenluft unter 30.000 Bq/m³. Höhere Aktivitäten wurden im Nohfeldener Becken und in Gegenden mit Muschelkalk (Bliesgau, Perl) mit Medianen von 62.000 Bq/m³ bzw. 68.000 Bq/m³ festgestellt. Vereinzelte Messergebnisse im Bliesgau liegen auch oberhalb von 100.000 Bq/m³. Solche erhöhten Werte sind aber die Ausnahme.
Je nach Höhe der gemessenen Radon-Belastung werden den Anwohnern und auch Hausbesitzern unterschiedliche Schutzmaßnahmen empfohlen.
Hintergrund:
Radon ist ein flüchtiges, radioaktives Edelgas. Über verschiedene Eintrittspfade kann Radon in Häuser gelangen und sich dort zu großen Mengen anreichern. Eine Gesundheitsgefährdung in Form eines erhöhten Lungenkrebsrisikos kann aus einem langfristigen Aufenthalt in solchen Gebäuden abgeleitet werden.
Per Gesetz muss ein Gebiet genau dann als Radonvorsorgegebiet ausgewiesen werden, wenn in mindestens 10% der Gebäude auf einer Fläche von mindestens 75% des auszuweisenden Gebietes der festgelegte Referenzwert von 300 Bq/m³ im Jahresmittel überschritten wird. In diesen Vorsorgegebieten gelten dann bestimmte gesetzliche Anforderungen zum Schutz vor Radon.
Um die Radonaktivität im Boden an einem Messpunkt zu definieren, werden üblicherweise drei Stellen, die in einem Abstand von 3 bis 5 Metern zueinander liegen, beprobt. Neben der Radonaktivität wird auch die sogenannte Bodenpermeabilität, also die Durchlässigkeit des Bodens für Radongas, an diesen drei Stellen bestimmt. Üblicherweise wird zur Charakterisierung des Messpunktes dann der höchste gemessene Wert herangezogen.